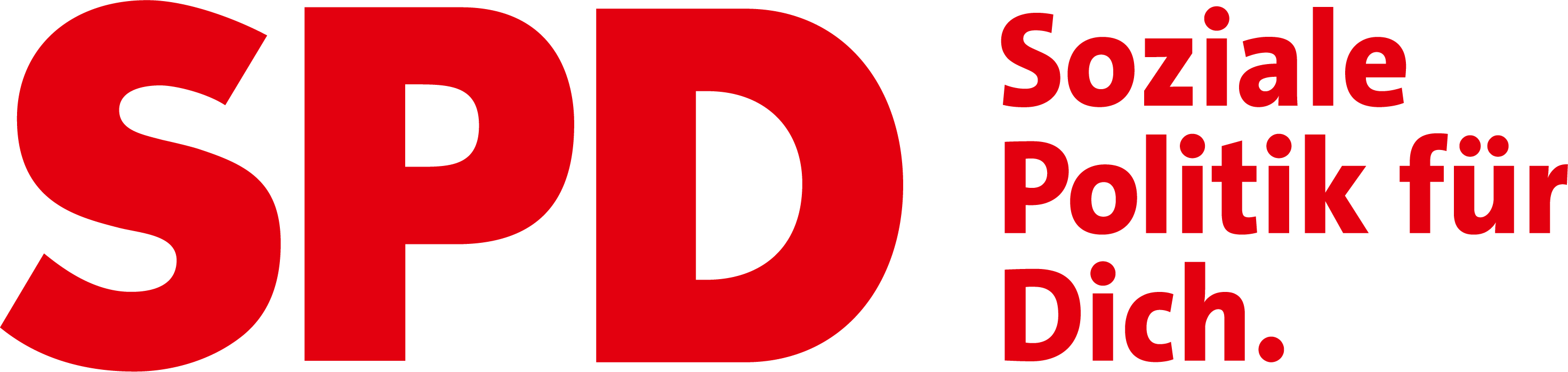Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Präsident! Als diese Koalition vor eineinhalb Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat, haben wir uns natürlich auch intensiv um die Finanzpolitik gekümmert. Wir haben festgelegt, dass wir so schnell wie möglich Haushalte aufstellen wollen, die ohne Neuverschuldung auskommen, und dass wir zusätzlich 23 Milliarden Euro – diese Zahl wurde damals genannt – zur Entlastung der Länderhaushalte und im Bildungsbereich investieren wollen. Darin waren auch 5 Milliarden Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur enthalten.
Nun, eineinhalb Jahre später, haben wir bereits für das Jahr 2014 im Vollzug einen ausgeglichenen Haushalt erreicht, sogar mit Überschüssen. Voriges Jahr haben wir auch für 2015 einen Haushalt ohne Neuverschuldung beschlossen. Dabei sind wir von einem geringeren Wachstum ausgegangen, als es nun der Fall ist. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern die Wachstumsprognose für 2015 und 2016 auf 1,8 Prozent hochgesetzt. Dieser Wert ist ein bisschen höher als der unseres Potenzialwachstums. Das zeigt: Wir profitieren von externen Faktoren wie dem niedrigen Ölpreis, dem niedrigen Euro-Kurs, den niedrigen Zinsen, aber auch davon – das ist der Schlüssel –, dass wir eine sehr konsequente, solide Finanzpolitik machen, auf die sich die Leute verlassen können. Dass sie sich darauf verlassen können, bringt uns Spielräume.
Jetzt stellt sich die Frage: Was machen wir mit den finanziellen Spielräumen, die wir durch die gute Wirtschaftsleistung – ich sage: auch durch die gestiegene Binnennachfrage, die ihre Ursache in der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns hat, weil die Leute wieder mehr Geld verdienen und Steuern zahlen können – zur Verfügung haben?
(Beifall bei der SPD)
Was machen wir mit diesen zusätzlichen Mitteln? Ich will auf meine Reden hier im Haus zum Haushalt 2015 verweisen. Ich habe bereits damals auf die bestehende Investitionslücke sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich hingewiesen. Es gab darüber einen Dissens.
(Steffen Kampeter (CDU/CSU): Genau!)
Ich kann mich an gegenteilige Veröffentlichungen aus dem Bundesfinanzministerium erinnern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand – ich weiß nicht, woher die Überschrift kommt; aber irgendwie muss sie ja Belang haben –, dass die CDU an einer Investitionslücke zweifelt. Ich halte diese Einschätzung für falsch und glaube auch nicht, dass sie gerechtfertigt ist; aber zumindest entsteht ein entsprechender Eindruck. Wir als Sozialdemokraten sagen jedenfalls klar: Wenn wir zukünftig unseren Wohlstand sichern wollen, dann müssen wir sowohl in die private als auch in die öffentliche Infrastruktur investieren. Denn nur wenn wir heute investieren, wird es uns auch in der Zukunft, in fünf oder zehn Jahren, gelingen, bei Produkten und Wettbewerbsfähigkeit an der Spitze der Welt zu sein und dadurch letztendlich gut bezahlte Arbeitsplätze zu sichern.
(Beifall bei der SPD)
So können wir die privaten Investitionen durch Rahmenbedingungen steuern.
Die öffentlichen Investitionen haben wir aber direkt in der Hand. Das ist unsere Verantwortung. Deswegen legt die Regierung heute hier einen Nachtragshaushalt vor – er ist natürlich auch unter Beteiligung des Parlaments aufgestellt worden –, über den wir in den nächsten Wochen beraten und entscheiden werden. Er sieht zwei entscheidende Maßnahmen vor.
Erstens. Die Bundesinvestitionen in die digitale Infrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur werden in den nächsten drei Jahren um 10 Milliarden Euro erhöht, zusätzlich zu allem, was wir bisher schon vereinbart haben. Das ist eine klare Richtung, für mehr Substanzerhalt, für mehr Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Deswegen begrüße ich diesen Vorschlag.
Der zweite Punkt betrifft die kommunale Infrastruktur. Bundesminister Schäuble hat darauf hingewiesen: Der Großteil der Investitionen in Deutschland wird von den Kommunen getätigt. In den vergangenen Jahren – da gebe ich Herrn Kollegen Bartsch recht; er zitierte aus Studien des Städte- und Gemeindebundes und von Wirtschaftsforschern – gab es Kommunen, die investiert haben, und manche, die deutlich zu wenig investiert haben, insbesondere diejenigen, die unter enormen Soziallasten leiden. Wir greifen jetzt diesen Kommunen unter die Arme, indem wir ihnen zusätzlich 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stellen. Ich hoffe und erwarte, dass die Länder das nicht nur kofinanzieren, sondern dieses Geld auch an die Städte und Gemeinden weitergeben. Denn auch unter dem Gesichtspunkt – Kollege Bartsch hat auf die Flüchtlingsströme hingewiesen –, dass wir in den nächsten Jahren große Anstrengungen unternehmen müssen, um Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren – Integration ist fast genauso wichtig –, muss die Leistungsbereitschaft der Kommunen gewährleistet sein. Wenn, wie in meiner Heimatstadt, erst einmal Turnhallen zur Unterbringung genutzt werden müssen, dann sinkt irgendwann auch die Bereitschaft der Bevölkerung – sie ist noch in großem Maße vorhanden –, die Flüchtlinge mit offenen Armen aufzunehmen. Das müssen wir verhindern. Es ist eine nationale Aufgabe, dass sie mit offenen Armen in der Gesellschaft aufgenommen werden und dass die Kommunen nicht überfordert werden. Deswegen ist dieses Investitionsprogramm der richtige Weg.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Zum Abschluss möchte ich noch etwas zu den privaten Investitionen sagen. Diese machen insbesondere bei den Unternehmensinvestitionen den absoluten Hauptteil aus. Der Anteil des Staats liegt, bezogen auf die privaten Unternehmensinvestitionen, bei 10 bis 20 Prozent. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, gehen diese Investitionen in den letzten Jahren zurück. Das ist ein alarmierendes Zeichen; denn wenn Unternehmen heute zu wenig in die Zukunftsfähigkeit von Produkten investieren, dann fehlt ihnen in zehn Jahren auf dem Weltmarkt, auf dem wir derzeit noch in vielen Bereichen führend sind, die Fähigkeit, Produkte zu guten Preisen zu verkaufen und unseren Wohlstand zu sichern.
Man stellt sich dann die Frage: Woran liegt das eigentlich? Dann muss man sich nur einmal die Gewinnausschüttungen anschauen, gerade bei den großen DAX-Konzernen. Wir haben hier ein Rekordhoch bei den Dividendenausschüttungen zu verzeichnen. Wenn bei den Unternehmen nur noch der Börsenkurs im Mittelpunkt steht, wenn sie möglichst kurzfristig ihren Kurswert steigern, indem sie hohe Dividendenausschüttungen quasi als Alternative zu den mangelnden Zinseinnahmen generieren, dann ist das eine gefährliche Situation. Es kann nicht sein, dass wir eine satte Gesellschaft werden, die auf Dauer nur noch davon lebt, dass die Unternehmen Dividenden ausschütten, und dass Unternehmenserben davon leben, dass die Unternehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut worden sind, Gewinne ausschütten, ohne in die Zukunft zu investieren. Das ist eine große Herausforderung. Alles, was wir als Politik tun können, was zum Beispiel die Rahmengesetzgebung bei der Energie, aber auch bei den Steuern betrifft, muss darauf gerichtet sein, dass wir Unternehmen in die Lage versetzen, wieder mehr in die Zukunft zu investieren, als sie es derzeit machen. Das ist im Übrigen auch eine Antwort auf die europäische Frage, was wir gegen zu geringe Unternehmensinvestitionen tun können.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.
Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Herr Präsident, ich komme zum Schluss.
Wir beraten in den nächsten Wochen über diesen Nachtragshaushalt. Auch der Verteilungsschlüssel wird – Kollege Bartsch hat darauf hingewiesen – Bestandteil dieser Beratungen sein und ist im Zusammenhang mit der zukünftigen Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern zu sehen; der Minister hat darauf hingewiesen. Auf diese Debatte freue ich mich sehr.
Danke sehr.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)