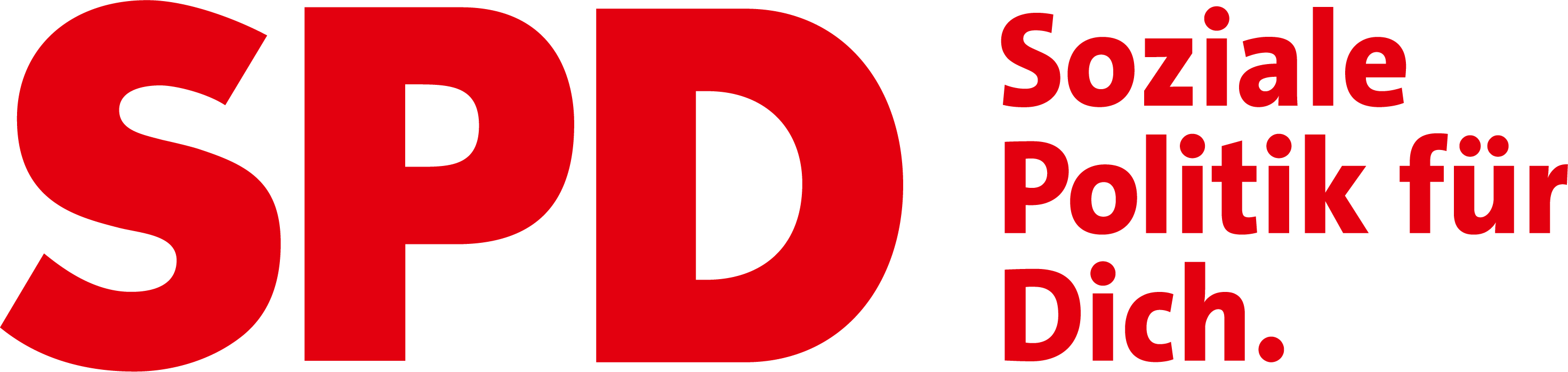Für das Buch „Mittendrin – Zukunftsentwürfe für eine älter werdende Gesellschaft“ (Hrsg. Garrelt Duin, Petra Ernstberger und Johannes Kahrs, Berlin 2011) habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Bananen werden braun, Menschen werden alt. Beiden zunächst rein äußerlichen Phänomenen liegen biochemische Prozesse zugrunde, die durch Umwelteinflüsse beschleunigt oder verzögert werden können. Sowohl bei Bananen als auch bei Menschen kennen wir die positive Erfahrung des widerlegten Anscheins: Die braune Schale umhüllt eine Vollreife, gesunde Frucht von unnachahmlicher Süße – und in einem von ersten Zipperlein und fortgeschrittenem Alter gezeichneten Körper waltet nicht selten ein ungemein kluger, wacher und innovativer Geist. Man denke etwa an den englischen Astrophysiker Stephen Hawking, der bereits seit 1968 wegen einer schweren Nervenkrankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist und mittlerweile nur noch über einen Sprachcomputer kommuniziert, den er mit Pupillenbewegungen steuert. Noch vor 100 Jahren wäre diesem Genie wohl die wissenschaftliche Karriere und wären uns allen damit die bahnbrechenden Erkenntnisse über die Struktur schwarzer Löcher und die Entstehung des Universums allein wegen seines körperlichen Zustandes verwehrt geblieben. Den fatalen Fehlschluss von äußerlichen Funktionseinschränkungen auf mangelnde innere Substanz hat die moderne Medizin glücklicherweise überwunden. Im Gegenzug gilt natürlich auch, dass vordergründige körperliche Intaktheit durchaus mit erheblichen innerlichen Defiziten einhergehen kann.
In unseren Debatten über die Umkehrung der Alterspyramide zeigt sich allerdings allzu häufig ein fataler Hang zur Einseitigkeit. Gewiss, die moderne Mediendemokratie zwingt zur Zuspitzung. Gezielte Provokation und pointiert formulierte Interessenvertretung eignen sich in einer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ als politische Instrumente. Doch wo hört das mediale Spiel auf und wo beginnt die bewusste Produktion gesellschaftlicher Spaltung?
Der breite öffentliche Diskurs über die Auswirkungen des demografischen Wandels und die Konsequenzen, die aus der damit verbundenen Alterung der Bevölkerung zu ziehen sind, hat sich in Deutschland während der vergangenen Jahre in der Auseinandersetzung mit zwei radikalen Sichtweisen entwickelt. Zunächst traf im Jahre 2003 ein frisch gekürter Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU) medial ins Schwarze, als er im Brustton der Überzeugung verkündete, er „halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen“. Auch wenn mittlerweile allgemein bekannt ist, dass die Äußerungen des JU-Vorsitzenden ganz in der Tradition seines Verbandes mehr eigener Eitelkeit als politischer Substanz geschuldet waren, verfehlten die damaligen Einlassungen zur Gesundheitspolitik ihre öffentliche Wirkung nicht. Von den Seniorenverbänden bis hin zur Deutschen Gesellschaft für Orthopädie tappte man in Philipp Mißfelders Falle, und in den Feuilletons wurde wochenlang ein „Krieg der Generationen“ geführt.
Die Fortsetzung dieses „Krieges“ besorgte dann in umgekehrter Stoßrichtung FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher im Jahr 2004 mit seinem – zugegeben hervorragend vermarkteten – Buch „Das Methusalem-Komplott“. Darin geißelt der Frankfurter Feuilletonchef durchaus zu Recht einen in Wirtschaft, Medien und Gesellschaft virulenten Jugendwahn, der eine Tendenz zur schleichenden Marginalisierung und Diffamierung des Alters in sich trage. Schirrmacher weiß, was dagegen zu tun ist, und fordert einen „Aufstand der Alten“. Niemand solle sich doch schämen müssen wegen seines Alters, und überhaupt würden die Älteren bald die deutliche Bevölkerungsmehrheit stellen. Insofern käme es jetzt darauf an, die Deutungshoheit über das Altersphänomen zu erringen und die mit Krankheit, Sturheit und Siechtum verbundenen gesellschaftlichen Vorurteile zu durchbrechen. Dazu erliegt Schirrmacher dann aber einer naheliegenden Versuchung und begibt sich auf das Glatteis unangemessener Idealisierung des Alters: Die empirisch belegte Steigerung der Lebenserwartung wird auf ungebrochen vitale Mittsiebziger projiziert, für die volle ökonomische, kulturelle und politische Teilhabe auch 2040 noch selbstverständlich sein wird. Auch wenn der Demografie-Bestseller von Schirrmacher die laienmedizinischen Einlassungen des JU-Vorsitzenden von 2003 im Hinblick auf intellektuelle Schärfe und Reflexionsniveau natürlich bei weitem übertrifft, so kann er doch als eine Art Generationen-Erwiderung gelesen werden nach dem Motto: „Ein Hüftgelenk ist nicht genug!“
Gerade an diesen Beispielen offenbart sich ein Widerspruch freier Gesellschaften im Informationszeitalter: Während der demokratische Rechtsstaat einerseits auf Meinungsfreiheit und öffentliche Debatte angewiesen ist, verknappt das damit entstehende informelle Überangebot die öffentliche Aufmerksamkeit und zwingt in noch nie da gewesenem Umfang zur Pointe. Unzulässige Vereinfachungen, gezielte Provokationen und Indiskretionen aller Art sowie die Bedienung von Vorurteilen setzen Themen auf die Agenda und verhindern gleichzeitig deren angemessene Bearbeitung. Die deutschen Feuilletons sind satt gefüllt mit solchen Pyrrhussiegen.
Einen vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung markierte jüngst Thilo Sarrazin: Einerseits hat er es mit seiner Publikation geschafft, die auch unter demografischen Gesichtspunkten zentralen Zukunftsthemen Einwanderung und Integration ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen, andererseits verhindern sensationsheischende Tabubrüche und abwegige Vereinfachungen einen produktiven Diskurs schon im Ansatz. Deutschland debattiert jetzt nicht über angemessene Sprachanforderungen, familiennahe Hilfsangebote oder interkulturelles Lernen, sondern über die Vererbung von Intelligenzquotienten. Lehrbuchartig!
Die Veränderung unserer Bevölkerungsstruktur darf aber nicht als Podium öffentlicher Selbstdarstellung missbraucht werden. Es gibt keinen Anlass zur Dramatisierung.
Die gesellschaftlichen Veränderungen sind weder das Verschulden einzelner Bevölkerungsgruppen, noch beschreiben sie einen politischen Ausnahmezustand. Nur auf dem Fundament dieser Einsicht sollten Sozialdemokraten den demografischen Wandel gestalten. Pauschale Schuldzuschreibungen, interessengeleiteter Aktionismus und fremdenfeindliche Abwehrkämpfe bieten keinerlei Orientierungshilfe. Im Verfassungsstaat des Grundgesetzes kann die Herausforderung der Bevölkerungsentwicklung nur angemessen bewältigt werden, wenn politisches Handeln zwei Grundsätzen folgt: Interessenausgleich und Anerkennung von Realitäten. Eine solche Politik hat die rechtlich geschützten Positionen und legitimen Erwartungen von Jung und Alt, von Singles und Familien, von Gesunden und Kranken, Männern und Frauen ebenso zu berücksichtigen wie von Einwanderern und der deutschen Ursprungsbevölkerung – und zugleich die praktischen Bedürfnisse der Lebenswirklichkeit im Auge zu behalten.
Die entscheidende Frage der kommenden Jahre wird dabei sein, ob es uns gelingt, die richtige Balance zwischen Markt und Staat zu finden. Wir müssen auf der einen Seite den Mut haben, dort, wo die alternde Gesellschaft selbst durch Angebot und Nachfrage die für sie besten Lösungen hervorbringt, Luft zum Atmen zu lassen, und auf der anderen Seite die Kraft aufbringen, da energisch gegenzusteuern, wo die Marktmechanismen den Einzelnen überfordern. So trägt die zunehmende Nachfrage junger Familien nach ansprechenden und vielfältigen Kita-Angeboten und schulischen Ganztagsformen positiv zu entsprechenden neuen Angeboten freier Träger bei. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrnehmung dieser Angebote allen Kindern möglich ist, unabhängig vom elterlichen Einkommen. Die alleinerziehende Fachverkäuferin darf ebenso berufstätig und Mutter sein wie Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Deshalb haben wir als Sozialdemokraten den Ausbau von Ganztagsschulen, den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Geburtstag und das Elterngeld durchgesetzt. Die jetzt von Schwarz-Gelb geplante Streichung des Elterngeldes für erwerbsfähige Hilfebedürftige sendet genau die falschen Signale: soziale Selektion statt Integration. Die für die Gestaltung des demografischen Wandels so wichtige Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht auch von einer anderen Seite unter Druck. Pflegebedürftigkeit von Eltern und Angehörigen wird in naher Zukunft eine ganz zentrale persönliche und zugleich finanzielle Herausforderung für die jüngere Generation werden. Auch auf diesem Gebiet wird die steigende Nachfrage im Idealfall zu produktivem Wettbewerb und Qualitätsverbesserungen bei stationären und ambulanten Leistungen führen – aber eben auch zu massiven Preissteigerungen. Es ist gut, wenn Besserverdienende und Vermögende ihren Angehörigen alle Segnungen des sich dynamisch entwickelnden Pflegemarktes zuteilwerden lassen können. Der Staat muss indes dafür Sorge tragen, dass von den Qualitätssteigerungen alle profitieren. Die unter Ulla Schmidt vollzogene schrittweise Anhebung des Pflegegeldes und die Einführung eines gesetzlichen Freistellungsanspruches für Arbeitnehmer, um die Pflege ihrer Eltern zu organisieren, waren Schritte in die richtige Richtung. Solidarische Reformen im Beitragsrecht, wie progressive Veranlagung und Einbeziehung von Kapitalerträgen sowie der weitere Ausbau des öffentlichen Qualitätsmanagements müssen folgen. Statt um gerechte Strukturen in der Kranken- und Pflegeversicherung kümmert sich die FDP jedoch lieber um den privaten Versicherungsmarkt: Luxuspflege für wenige und Minimalleistungen für den Rest.
Dasselbe Bild zeigt sich bei der nötigen Anpassung kommunaler Infrastruktur. Die Marktakteure investieren schon länger in altersgerechte Wohnobjekte und barrierefreie Bestandsumbauten. Wo der Markt nicht investiert, sollte die öffentliche Städtebauförderung regulierend eingreifen. Gerade diese Programme lässt Schwarz-Gelb nun auslaufen. Das zynische Motto dahinter: Wer alt und arm ist, braucht keinen Fahrstuhl im Haus.
Der deutsche und europäische Arbeitsmarkt wird in Zukunft mehr denn je auf qualifizierte Zuwanderer angewiesen sein. Hier ist Mut zum Laisser-faire angezeigt: Fremdenfeindlichkeit und rassistische Vorurteile werden in den ländlichen Regionen hoffentlich mit dem Weisheitszahn verschwinden, den der pakistanische Zahnarzt kunstgerecht entfernt hat. Vor Parallelgesellschaften schützen Investitionen in Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe, nicht Leitkulturdebatten und „Integrationsgipfel“ im medialen Schaufenster.
Deutschland feiert in diesem Herbst 20 Jahre Wiedervereinigung. Während die SED Klassenkampf spielte, haben die Ostdeutschen auch braune Bananen gekauft. Und diese haben nicht selten am besten geschmeckt. Die Erfahrung, dass das Leben jenseits der offiziellen Schwarz-Weiß-Malerei viele Graustufen bietet, hat den Alltag in der DDR sicher erträglicher und die Parteipropaganda erfolgloser gemacht. Ostdeutsche haben gelernt, die Wahrheit über gesellschaftliche Zustände nicht in Leitartikeln und Parteitagsbeschlüssen zu suchen, sondern in der Kaufhalle um die Ecke und im Wohnhaus auf der anderen Straßenseite. Dieser spezielle Sinn für das Lebenspraktische hat sowohl moskautreue Kommunisten als auch westdeutsche Anlagebetrüger überstanden – und tritt den neuen demografischen Herausforderungen ganz nüchtern entgegen, etwa mit dem phasenweisen Rückbau von Plattenbauten oder der ökologischen Sanierung von Industriebrachen. Der demografische Wandel ist weder gut noch böse, sondern im Rahmen von anstrengenden, aber notwendigen Abwägungen gerecht zu gestalten. Dass es dabei nicht das Schlechteste ist, wenn sich ostdeutscher Pragmatismus an Bananen orientiert, hat die jüngere deutsche Geschichte eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
(c) Mittendrin – Zukunftsentwürfe für eine älter werdende Gesellschaft