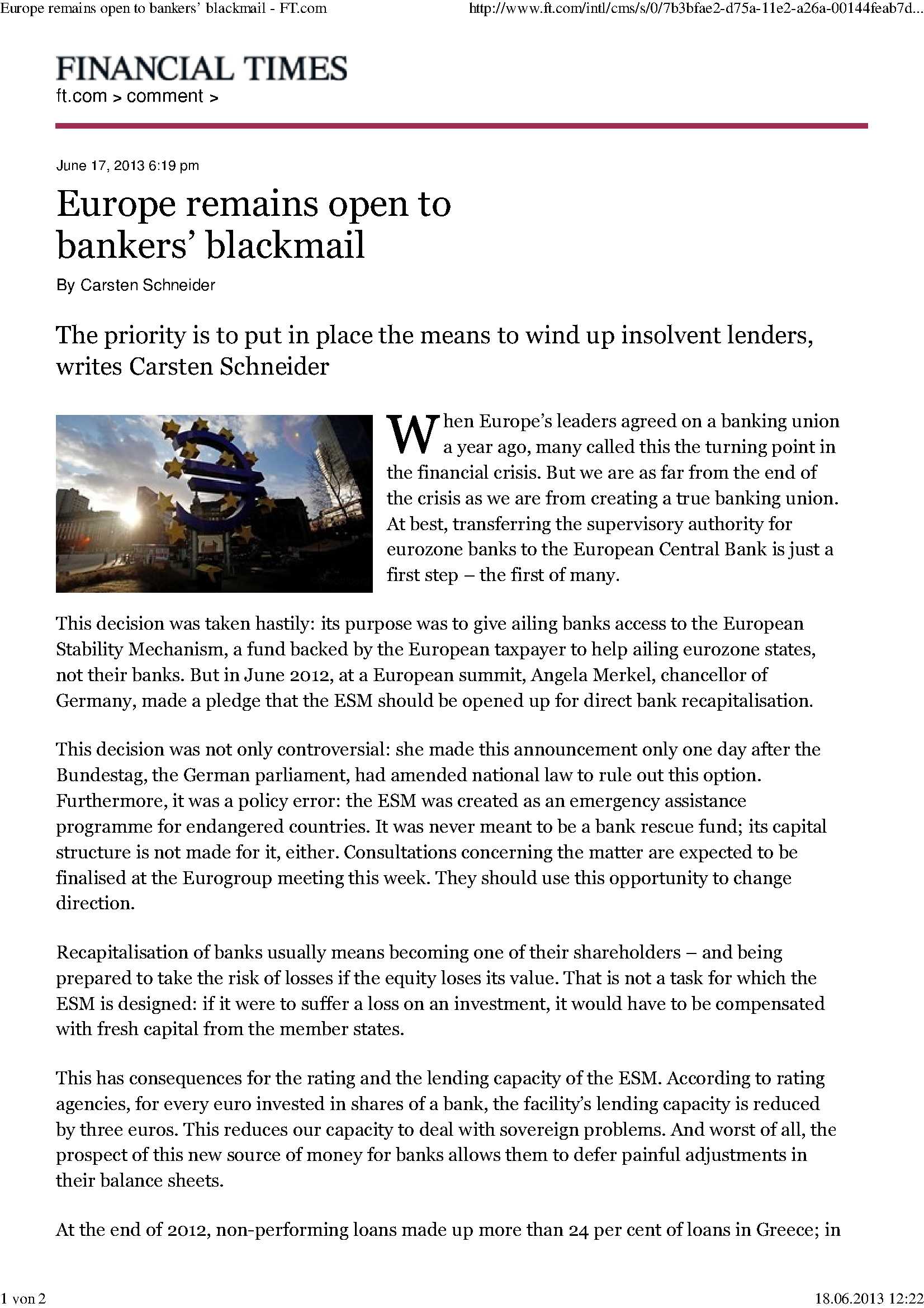Zusammen mit Jakob von Weizsäcker, Thüringer SPD-Europaabgeordneter, habe ich für die heutige Frankfurter Rundschau folgenden Beitrag verfasst:
Zur Beteiligung der SPD in einer rot-rot-grünen Regierung habe ich für die heutige Thüringer Allgemeine folgenden Beitrag verfasst:
Zu den Ergebnissen der Hauptversammlung der Deutschen Bank habe ich für das heutige Handelsblatt folgenden Beitrag verfasst:
Die Hauptversammlung der Deutschen Bank hat Signalwirkung. Die Bank will ihr Eigenkapital um acht Milliarden Euro erhöhen, um sich weiter im Investmentbanking zu engagieren. Damit sind höhere Risiken verbunden, die viele andere Banken an den Abgrund brachten. Sie mussten mit Steuergeld gerettet werden, sogar ganze Staaten – Irland, Spanien, Zypern – kamen in Bedrängnis.
Viele Großbanken ziehen sich aus dem Investmentbanking zurück und bauen Risiken ab. Die Deutsche Bank tut das Gegenteil. Die Eigentümer haben entschieden, dass das im Bankeninteresse liegt. Im öffentlichen Interesse liegt es dagegen nicht: Wir müssen das öffentliche Gut der Finanzstabilität schützen. Trotz Basel III und Bankenunion in der EU zeigt sich: Die Investmentbanker der Großbanken sind nicht zu stoppen.
Daher brauchen wir zusätzliche Maßnahmen. Kreditinstitute, die Investmentbanking betreiben, müssen mehr Eigenkapital vorhalten. Großbritannien und die Schweiz verlangen etwa 19 Prozent. Nach Basel III ist das möglich. Der zusätzliche Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 Prozent kann durch die BaFin um einen Puffer für systemische Risiken von bis zu fünf Prozent und um einen Puffer für systemrelevante Institute von bis zu 3,5 Prozent erhöht werden. Die Bankenaufsicht muss mutiger werden, um die Finanzstabilität zu sichern.
Langfristig muss das Investmentbanking vom Kundengeschäft getrennt werden. Die USA sind mit dem Dodd-Frank-Act vorangegangen. Für Europa hat die Liikanen-Kommission sinnvolle Vorschläge für ein Trennbankensystem gemacht. Die SPD hat im Koalitionsvertrag durchgesetzt, die Liikanen-Vorschläge als Blaupause zu nutzen. Ein weiteres Signal betrifft den „Kulturwandel“ der Deutschen Bank, der sich nun als PR-Gag entpuppt hat: Die Hauptversammlung hat die Grenze für die variable Vergütungskomponente für Vorstände und Mitarbeiter heraufgesetzt. Berichten zufolge hat die Bank 2012 eine Rendite von 0,5 Prozent, im Jahr 2013 von 1,2 Prozent vor Steuern erzielt. Dabei fuhr das Investmentbanking Verluste in dreistelliger Millionenhöhe ein.
Die Konsequenzen? Im Jahr 2012 wurden 2,19 Milliarden Euro Boni ausgeschüttet, aber nur 237 Millionen Euro an die Eigentümer, 2013 waren es 2,13 Milliarden Euro Boni, 666 Millionen für die Eigentümer. 84 Prozent der Boni gingen an Investmentbanker. Ich frage: Wem gehört eigentlich die Deutsche Bank? Für wen wirtschaftet sie? Für die Deutsche Bank müsste die These des Ökonomen Thomas Piketty umgeschrieben werden: Die Investmentbanker werden reicher, die Ungleichheit steigt.
Deshalb müssen wir politisch handeln. Seit 2014 dürfen in Europa Boni nicht höher als die Festvergütung sein (1:1), maximal aber 1:3 nach Beschluss der Hauptversammlung. Doch das wird heute schon umgangen und reicht nicht, um den Selbstbedienungsladen zu beenden.
Wir werden diesem Spuk also nur ein Ende setzen, wenn Boni nicht länger steuerlich als Betriebsausgabe absetzbar sind. Ein Bonus ist ein Geschenk – und muss damit aus dem Gewinn nach Steuern bezahlt werden. Dort, wo Vernunft hartnäckig ignoriert wird, ist der Gesetzgeber gefragt. Es wird Zeit, dafür einen neuen Anlauf zu nehmen.
(c) Handelsblatt
Für den heutigen „DER HAUPTSTADTBRIEF“ habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Was bringt Deutschland und seinen Unternehmen die Europäische Union? Politische Stabilität. Zusätzliches Wachstumspotenzial. Offene Märkte. Das ist ein Riesengewinn, den wir für Deutschland haben. Man kann es nicht oft genug sagen – denn wir vergessen es sonst allzu leicht. Nichtsdestotrotz: Was die Finanzpolitik betrifft und den Euro und die Unabhängigkeit der Nationalstaaten in ihrer Fiskalpolitik und die Trennung der Geld- und Fiskalpolitik – da, denke ich, sind noch etliche Hausaufgaben zu machen. Und da wird es nicht genügen, nur den Stabilitätspakt einzuhalten, und alles wird gut.
Die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB), in Deutschland immer sehr kritisch gesehen, war gut. Sie war sehr effizient – ökonomisch gesehen. Sie hat funktioniert. Aber deckt sich das auch mit der politischen Einschätzung? Nicht ganz. Denn die EZB muss ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen. Sie ist nicht frei in ihren geldpolitischen Entscheidungen. Sie mischt sich in die Politik ein, und das ist nicht ihre Aufgabe. Sie hat nicht politische Vorgaben zu liefern, und auch nicht im Rahmen der Troika wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben.
Wie kann die Rückkehr zur geldpolitischen Unabhängigkeit verwirklicht werden? Ich denke nicht, dass wir noch mehr Vorgaben zu Papier bringen müssen, die im Zweifel politisch ausgelegt und entschieden werden. Die wichtige Frage wird sein, ob wir den notwendigen Schritt hin zu einer deutlich stärkeren Fiskalunion gehen werden. Der Fiskalvertrag wurde geschlossen, um – wie wir es in Deutschland mit der Schuldenbremse haben – in Europa Nationalstaaten stärker zu binden, als das über den Maastricht-Vertrag geregelt war.
Das heißt Steuerpolitik und Haushaltspolitik nicht mehr alleine im Deutschen Bundestag oder in der Assemblée Nationale zu entscheiden, sondern stärker koordiniert und auch sanktioniert durch eine europäische Institution. Wie das im Einzelnen vonstattengehen kann in einer EU der 28 – das ist eine offene Frage, die wir in den nächsten zwei Jahren, der Zeit, die uns die Zentralbank jetzt gekauft hat, klären und umsetzen müssen.
Da sind große Schritte zu machen hin zu einer Fiskalunion. Einige sind wir bereits gegangen. Wir haben nationale Souveränität abgegeben. Die großen Banken in Deutschland werden von der EZB zukünftig beaufsichtigt. Ich halte das für richtig in einem Binnenmarkt, der über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg gerade im Bankenbereich zu Verflechtungen geführt hat, die es unmöglich machen, eine große Bank wie beispielsweise die Deutsche Bank noch national zu kontrollieren, geschweige denn im Extremfall abzuwickeln.
Das Hin zu einer Fiskalunion bedeutet aber auch, die Steuerpolitik stärker zu koordinieren und zu vergemeinschaften – Beispiel Bankenabgabe, die wir schon haben. Das Volumen hier in Deutschland reicht nicht aus. Sie wird wahrscheinlich um das Dreifache steigen, um den Fonds bis Ende 2023 mit 55 Milliarden Euro zu füllen. Die spannende Frage ist: Ist diese Abgabe dann abzugsfähig von der Steuerschuld? In Deutschland ist das nicht der Fall. Dazu gibt es allerdings keine Regelung im Vertrag. Ich halte das für einen großen Fehler, denn ich kann mir schon kleinere Länder mit großem Bankensektor vorstellen, die die Bankenabgabe nicht steuerlich abzugsfähig machen werden. Dann wird der Druck auch in Deutschland steigen, sie nicht abzugsfähig zu machen. Das aber würde bedeuten, dass das Wort der Bundeskanzlerin „Wir werden nie wieder für die Verluste von Banken zahlen“ ad absurdum geführt würde – denn dann läge etwa ein Drittel der Kosten beim deutschen Steuerzahler.
Das heißt: Wir haben jetzt noch die Chance zur Korrektur. Wir dürfen in Europa die Steuerpolitik nicht für Wettbewerbszwecke missbrauchen lassen – mit Verlusten für die Allgemeinheit und im Endeffekt mit der Gefahr, dass uns die Ausgaben über den Kopf wachsen, die Steuerbelastung in Deutschland steigt. Deshalb sind auch Initiativen wie das vom Bundesfinanzminister schon in der vergangenen Legislaturperiode angestoßene „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) so wichtig, mit dem Ziel der Schließung von Steuerschlupflöchern legaler Art.
Es ist zur Zeit überall von der Währungsunion die Rede, aber kaum jemand spricht über die wirtschaftspolitische Koordinierung. Gerade sie scheint mir aber viel stärker in den Mittelpunkt zu gehören. Vorrangig ist doch, ob strukturelle Reformen tatsächlich stattfinden in den Ländern, so wie wir es in Deutschland Mitte der 2oooer-Jahre – und ich sage als Sozialdemokrat: zu Recht – gemacht haben. Wir hätten sonst dieses Wachstum nicht. Wir wären heute sonst auch nicht der Stabilitätsanker in Europa. Die Ernsthaftigkeit, sich in der öffentlichen Debatte damit auseinanderzusetzen, was von den Ankündigungen von Reformen in den Ländern wie Frankreich oder Italien tatsächlich umgesetzt wird, lässt zu wünschen übrig.
Es wird zu sehr auf die fiskalischen Zahlen gesehen und zu wenig auf die strukturellen Reformen geachtet. Auch das bedeutet eben einen Verzicht auf nationale Kompetenz. Und es wird sicherlich interessant werden, das mit den Franzosen und Italienern zu diskutieren – egal, ob sie Sozialisten oder Konservative sind.
Für die heutige Financial Times habe ich folgenden Gastbeitrag verfasst:
When Europe’s leaders agreed on a banking union a year ago, many called this the turning point in the financial crisis. But we are as far from the end of the crisis as we are from creating a true banking union. At best, transferring the supervisory authority for eurozone banks to the European Central Bank is just a first step – the first of many.
This decision was taken hastily: its purpose was to give ailing banks access to the European Stability Mechanism, a fund backed by the European taxpayer to help ailing eurozone states, not their banks. But in June 2012, at a European summit, Angela Merkel, chancellor of Germany, made a pledge that the ESM should be opened up for direct bank recapitalisation.
This decision was not only controversial: she made this announcement only one day after the Bundestag, the German parliament, had amended national law to rule out this option. Furthermore, it was a policy error: the ESM was created as an emergency assistance programme for endangered countries. It was never meant to be a bank rescue fund; its capital structure is not made for it, either. Consultations concerning the matter are expected to be finalised at the Eurogroup meeting this week. They should use this opportunity to change direction.
Recapitalisation of banks usually means becoming one of their shareholders – and being prepared to take the risk of losses if the equity loses its value. That is not a task for which the ESM is designed: if it were to suffer a loss on an investment, it would have to be compensated with fresh capital from the member states.
This has consequences for the rating and the lending capacity of the ESM. According to rating agencies, for every euro invested in shares of a bank, the facility’s lending capacity is reduced by three euros. This reduces our capacity to deal with sovereign problems. And worst of all, the prospect of this new source of money for banks allows them to defer painful adjustments in their balance sheets.
At the end of 2012, non-performing loans made up more than 24 per cent of loans in Greece; in Spain the ratio increased to more than 11 per cent; in Portugal the figure stood at 10 per cent – double that of the previous year. In Ireland, more than 15 per cent of all property loans for owner-occupied real estate are behind in payment.
The prospect of an ESM bailout takes the pressure off the banks to deal with these losses. Opening the fund for the direct recapitalisation of banks will not break the vicious circle of government debt and bank risks. Quite the contrary: it would become even worse. A supervisory institution without the authority to wind up failing banks is, in effect, a guarantee of survival for big banks. The ESM would strengthen their capacity to blackmail the public.
This is why we urgently need an independent institution to wind up insolvent banks. It must have the right to close down banks and must be up and running at the same time as the supervisory authority.
In order to make it possible to shut down banks without wider spillover effects, we also need a resolution fund, financed by the financial sector. Some of the revenue of a financial transaction tax could be used – and the willingness of a country to introduce this tax could be a precondition for joining the supervisory mechanism. It would be a way to make sure that countries with a large financial sector implement the FTT – particularly current holdouts such as Luxembourg, Britain or Ireland.
After all, what is the alternative? A patchwork of national resolution regimes,as suggested recently by Ms Merkel and President François Hollande of France is no viable solution as many banks operate across borders. A real banking union would be a tremendous step towards more European integration. Nobody should fear the necessary treaty changes. The ESM was set up through a small treaty change on short notice, too.
Member states should remain responsible for banks’ legacy assets, since they occurred under national supervision. Financial aid should remain confined to countries only, and it must remain linked to macroeconomic adjustment programmes. But if we want to continue towards a fiscal union, we need to find a solution to the problem of our outsized public debt. Instead of making it a more serious problem with new tax money via the ESM, we should make sure that European banks can fail.
The writer is spokesman on finance in the Bundestag for Germany’s Social Democratic party.
(c) Financial Times
Für die heutige DIE ZEIT habe ich folgenden Gastbeitrag verfasst:
Die Zypernhilfe war ein entscheidendes Novum in der europäischen Krisenpolitik: Erstmals wurden die Gläubiger einer Bank bei deren Abwicklung einbezogen – statt wie bisher wegen gefürchteter Marktreaktionen überwiegend die Steuerzahler zu belasten. Damit hat der neue sozialdemokratische Vorsitzende der Eurogruppe Dijsselbloem Maßstäbe für die Zukunft gesetzt. Denn das Grundproblem der Refinanzierungskrise ist der Infektionskanal zwischen maroden Banken und Staatsfinanzen. Er muss trocken gelegt werden.
Wer Risiken für einen höheren Profit eingeht, der muss auch für Verluste gerade stehen. Banken müssen scheitern können. Sie dürfen nicht wegen ihrer Größe ganze Staaten als Geisel nehmen. Dieses Ziel erfordert zwei Maßnahmen: eine einheitliche, starke europäische Bankenaufsicht und eine unabhängige Abwicklungsinstitution mit dem Recht, insolvente Banken zu schließen – samt eines vom Finanzsektor bezahlten Fonds. Künftig müssen Banken für Banken haften, nicht die Steuerzahler.
Doch Bundeskanzlerin Merkel hat eine andere Richtung eingeschlagen. Sie ließ den Einstieg in eine Bankenunion zu, aber sorgte zugleich für den direkten Zugang von Banken zu den Rettungsgeldern im ESM, die eigentlich in Not geratenen Staaten vorbehalten sind. Die einzige Bedingung war, dass der EZB die Rolle als gemeinsame Bankenaufsicht übertragen wird.
Damit hat Merkel den ESM von einem Rettungsfonds für Staaten in einen Rettungsfonds für Banken umgewandelt, obwohl der Bundestag genau das bei der Ratifizierung des ESM-Vertrages gesetzlich ausgeschlossen hat. Trotzdem sollen die Verhandlungen darüber in Brüssel bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die anderen Länder pochen auf das Wort der Kanzlerin. Doch die scheut die dafür notwendige Gesetzesänderung in Deutschland vor der Wahl. Die SPD hat diesen Weg von Anfang an abgelehnt, weil damit der Teufelskreis zwischen Banken und Staaten verstärkt wird.
Gerade erst haben die EU-Finanzminister eine mit heißer Nadel gestrickte Verordnung abgesegnet, mit der die Aufsicht der EZB übertragen werden soll.
Der Bundestag muss dieser Verordnung bis Mitte Juni noch zustimmen, weil damit nationale Hoheitsrechte in einem ungekannten Ausmaß auf die EZB übertragen werden. Geschieht das, avanciert die EZB zur mächtigsten EU-Institution – ohne demokratisch legitimiert und kontrolliert zu sein. Weil die Bundeskanzlerin nicht über eine eigene belastbare Mehrheit im Bundestag verfügt, ist der EZB bereits jetzt die Rolle des Retters der letzten Instanz zugewachsen. In ihrer neuen Rolle wäre sie aber mit internen Interessenkonflikten konfrontiert, die ihr eine objektive Beurteilung der Lage der Banken deutlich erschwerten. Schließlich setzt die EZB mit ihrer Zinspolitik nicht nur den Rahmen für die Märkte, sondern steuert mit der enormen Vergabe von Liquidität den Geldfluss an die Banken. Wie aber soll die EZB eine Bank objektiv regulieren, wenn sie gleichzeitig deren Geschäftspartner und Gläubiger ist? Eine Fehlentscheidung bei der Aufsicht würde die EZB als Institution erheblich beschädigen. Auch hier müssen Lehren aus Zypern gezogen werden: Die dortige Zentralbank war als Aufsichtsbehörde dafür mit verantwortlich, dass der Finanzsektor eine absurde Größe erreichen konnte und die Banken enorme Risiken eingingen. Zugleich versorgte die Zentralbank die Banken trotz absehbarer Schwierigkeiten weiter mit Geld. Das darf sich nicht wiederholen.
Wir sollten die Bankenaufsicht der EZB deshalb nur befristet übertragen. Ziel muss eine neue, unabhängige Institution sein, ergänzt um eine von ihr unabhängige europäische Abwicklungsbehörde, die das Recht hat, Banken zu schließen und vom Markt zu nehmen. Doch die Errichtung eines europäischen Abwicklungsregimes wird derzeit blockiert, auch von Deutschland.
Gerade die Länder mit großen Finanzsektoren haben ein Interesse an der neuen Aufsicht, weil sie ihre Risiken dann auf die europäischen Steuerzahler verlagern können. Eine Aufsicht ohne das Damoklesschwert der Abwicklung ist eine Überlebensgarantie für Großbanken und stärkt deren Erpressungspotential – eine kostenlose Vollkaskoversicherung mit Doppelairbag. Daher muss die Zustimmung zur Aufsicht verbunden werden mit der gleichzeitigen Einführung eines Bankenabwicklungsrechts und einem Abwicklungsfonds, der durch den Finanzsektor finanziert wird. Dafür kann anfangs auch ein Teil des Aufkommens aus der Finanztransaktionssteuer genutzt werden. Die Bereitschaft eines Landes, diese Steuer einzuführen, muss die Voraussetzung sein, dem Aufsichtsmechanismus beitreten zu dürfen. So wäre auch sichergestellt, dass Staaten mit einem großen Finanzsektor mehr in den Fonds einzahlen als andere. Aber gerade diese Länder, u. a. Luxemburg, Malta, Großbritannien, Irland, blockieren eine solche Beteiligung der Finanzindustrie.
Ein Flickenteppich aus nationalen Abwicklungsregimen – wie von Finanzminister Schäuble vorgeschlagen – ist dagegen keine taugliche Lösung. Viele Banken agieren grenzüberschreitend und müssen auch so behandelt werden. Dazu gehört auch die notwendige Transparenz ihrer Bilanzen. Aber weil die Bundeskanzlerin die Tür für die Rekapitalisierung der Banken aus dem ESM geöffnet hat, warten die anderen Länder auf diese Möglichkeit, anstatt die Bankbilanzen zu bereinigen und Banken vom Markt zu nehmen.
Die Bankenunion ist ein gewaltiger Integrationsschritt in Europa und ein Meilenstein auf dem Weg in eine Fiskalunion. Sie muss gut vorbereitet sein. Sonst kann es für den Steuerzahler richtig teuer werden.
(c) Die Zeit
Für den heutigen „DER HAUPTSTADTBRIEF“ habe ich folgenden Beitrag verfasst:
„Zypern retten.“ Heißt das, russische Anleger von deutschen Steuerzahlern retten zu lassen? Die SPD will die deutschen Steuerzahler genau vor so einer Entwicklung schützen. Damit eben nicht die deutschen – und im übrigen alle europäischen Steuerzahler – bei einer Zypern-Rettung die Lasten zu tragen haben, knüpft die SPD eine Zustimmung zu Finanzhilfen an Zypern an feste Forderungen: Ohne eine Beteiligung von Nutznießern des zypriotischen Geschäftsmodells darf es keine europäischen Hilfen für das Land geben.
Darüber hinaus muss sich das Geschäftsmodell Zyperns grundlegend ändern: Steuerdumping, die laxe Handhabung von Schwarzgeldtransfers und die Konzentration der Wirtschaftskraft auf einen überdimensionierten und nicht ausreichend beaufsichtigten Bankensektor müssen beendet werden. Erst dann darf es eine Finanzhilfe an Zypern aus dem ESM geben.
Richtig ist: Zypern hat einen Anspruch auf Hilfe – wie alle anderen Euro-Länder auch. Aber Hilfe ist keine Einbahnstraße: Zuvor muss Zypern Reformen im eigenen Land zustimmen. Die Finanzprobleme des Landes sind die Folge eines aufgeblähten Finanzsektors. Mit Bilanzaktiva von aktuell 125 Milliarden Euro ist der Finanzsektor um ein siebenfaches größer als die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes. Seit Ende 2005 hat sich die Bilanzsumme des Finanzsektors verdoppelt. Zypern ist zu einer Durchlaufstation für Finanzgeschäfte geworden. Die Verbindlichkeiten der ins internationale Geschäft verwickelten zypriotischen Banken bestehen zu einem großen Teil aus Einlagen von außerhalb der Eurozone. Sie wurden von dem besonderen „Geschäftsmodell“ Zyperns angezogen: von niedrigen Steuersätzen, einer laxen Handhabung von Identitätskontrollen bei Kontoeröffnungen sowie den Besonderheiten beim Staatsangehörigkeitsrecht.
Am 25. Juni 2012 hat Zypern einen Antrag auf Finanzhilfe aus dem Rettungsfonds ESM gestellt. Finanzminister Schäuble und Kanzlerin Merkel haben sich nicht wirklich um dieses Problem gekümmert. Von Anfang an hat die SPD im Haushaltsausschuss mehrfach den Verhandlungsstand und die Positionen der Bundesregierung zur möglichen Finanzhilfe an Zypern nachgefragt. Und die SPD hat eigene Anforderungen an eine Zypern-Hilfe formuliert, so unter anderem nach einer effektiven Gläubigerbeteiligung. Damit diejenigen an den Kosten beteiligt werden, die zuvor in Zypern mit ihren Einlagen Geld verdient haben.
Die Analyse des Finanzdienstleisters PIMCO (Pacific Investment Management Company, eine US-Tochter der globalen Versicherungsgesellschaft Allianz – Anm. d. Red.) zum Bankensektor ist inzwischen abgeschlossen und wurde offenbar auch von der Eurogruppe diskutiert. Eine Veröffentlichung soll erst nach Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ als Vereinbarung zwischen Zypern und den Euro-Mitgliedsländern erfolgen. Es ist ein Skandal, dass der Bundestag dazu bisher keine Informationen erhalten hat. Die mangelnde Informationspolitik der Bundesregierung ist nicht akzeptabel, da der Bankensektor den größten Teil des Finanzbedarfs Zyperns verursacht.
Nach dem die Bundesregierung bisher jegliche Maßnahmen gegen einen unkontrollierten Kapitalabfluss abgelehnt hat, werden nun in Folge der Entscheidung der Eurogruppe zusätzliche Bankschließtage notwendig, um eine Panik in Zypern zu verhindern. Der Beschluss der Eurogruppe, neben der notwendigen Einbeziehung hoher Geldanlagen auch die von der Einlagensicherung garantierten Kontobestände zur Rekapitalisierung der zypriotischen Banken heranzuziehen, kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden und droht eine neue Welle der Krise zu entfachen. Mit leichtfertigen Dilettan-tismus wurde die Finanzstabilität der Eurozone insgesamt aufs Spiel gesetzt. Für diese Verunsicherung trägt auch der deutsche Finanzminister eine wesentliche Verantwortung.
Die SPD lehnt das vorliegende „Memorandum of Understanding“ als Verhandlungsgrundlage ab. Eine Zustimmung zu Finanzhilfen an Zypern knüpft die SPD an konkrete Forderungen, die das Land erfüllen muss:
Erstens: Der Finanzsektor des Landes muss deutlich verkleinert werden und auf ein für die volkswirtschaftliche Größe des Landes angemessenes Maß schrumpfen. Der Bankensektor muss nach einem Stresstest unter Aufsicht der Europäischen Kommission konsolidiert werden. Nicht überlebensfähige Institute sind abzuwickeln. Um die Kosten für die Rekapitalisierung der zypriotischen Banken zu minimieren, ist eine weitgehende Verlustbeteiligung der Eigentümer und Gläubiger der Banken vorzusehen. Eine direkte Rekapitalisierung der Banken durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, jetzt oder in Zukunft ist ausgeschlossen.
Zweitens: Vor Unterzeichnung des Anpassungsprogramms für Zypern muss zur Sicherung und Einhaltung der Anti-Geldwäschestandards der „Financial Action Task Force“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, eine Mission aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und OECD einen Bericht vorlegen. Zur Begleitung des Programms wird eine dauerhafte Mission der EU-Kommission vor Ort die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren und monatlich an die Eurogruppe berichten. Die zypriotische Regierung verpflichtet sich, den Vertretern der Kommission ein umfassendes Einsichts- und Auskunftsrecht gegenüber allen Stellen zu gewähren.
Drittens: Um die Einnahmen des Staatshaushaltes zu verbessern und Steuerdumping zu vermeiden, muss Zypern die Ertrags- und Unternehmenssteuersätze auf die Durchschnittssätze der Euro-Mitgliedsstaaten anheben, private Kapitalerträge mit Hilfe einer Quellensteuer lückenlos besteuern und die Bemessungsgrundlagen verbreitern sowie die umfassende Erteilung von Auskünften an die anderen Mitgliedsstaaten sicherstellen. Darüber hinaus ist eine Anhebung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommenssteuer zu prüfen. Zu den notwendigen Reformen gehört auch eine stärkere Unterstützung der zypriotischen Regierung durch die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten bei der Verbesserung der Steuerverwaltung.
Viertens: Zur Unterstützung der Initiative zur verstärkten Zusammenarbeit führt Zypern gemeinsam mit den anderen Mitgliedsstaaten die Finanztransaktionssteuer ein und leistet so einen Beitrag zu einer verursachergerechten Lastenteilung bei den Kosten der Finanzkrise für die öffentlichen Haushalte.
Wenn die Rettung Zyperns auf der Grundlage dieses Anforderungskatalogs erfolgt, werden die Verursacher der Krise angemessen an den Kosten beteiligt und zukünftigen Fehlentwicklungen wird entgegengewirkt.
Für die heutige Thüringer Allgemeine habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Der „Aufbau Ost“ ist nicht abgeschlossen. Noch immer liegt der Osten bei den meisten Wirtschaftsindikatoren deutlich hinter dem Westen zurück. Wahr ist aber auch: Was die öffentlichen Haushalte betrifft, stehen die ostdeutschen Bundesländer besser da als die vergleichbaren finanzschwachen westdeutschen Flächenländern. Die Einnahmen der ostdeutschen Länder liegen – pro Kopf gerechnet – ungefähr ein Fünftel höher. Der Grund sind die Solidarpakt- Gelder und die Fördermittel aus den Strukturfonds der EU. Allerdings nehmen beide Finanzströme immer weiter ab. Wohl noch in diesem Jahrzehnt werden die Einnahmen der Ostländer unter das Niveau der westdeutschen Flächenländer fallen.
Der Solidarpakt II, also die Sonderhilfen des Bundes an die ostdeutschen Länder, endet im Jahr 2019. Klar ist: Politisch wäre ein Solidarpakt III als exklusive Ostförderung niemals durchsetzbar. Die ostdeutschen Bundesländer müssen sich auf die Zeit danach vorbereiten. Die große finanzpolitische Herausforderung der kommenden Jahre besteht darin, die Haushalte von Ländern und Kommunen den sinkenden Einnahmen anzupassen. Berechnungen des Sachverständigenrates zufolge muss Thüringen seine laufenden Ausgaben zwischen 2011 und 2020 um 18,6 Prozent reduzieren, damit ein ausgeglichener Haushalt erreicht wird. Daneben warnt der Sachverständigenrat vor längerfristigen Haushaltsrisiken: Unter anderem werden die Versorgungsausgaben der neuen Länder in den kommenden Jahrzehnten stark ansteigen.
Mit welcher Strategie können die ostdeutschen Bundesländer den enormen Anpassungsprozess, der vor ihnen liegt, bewältigen? Seriöse Haushaltskonsolidierung ist nur über einen Dreiklang zu erreichen aus Einsparungen, zielgerichteten Investitionen und zusätzlichen Mitteln. Ein Prozess, an dem alle staatlichen Ebenen gleichermaßen beteiligt sein müssen.
Kein Weg führt daran vorbei, alle verfügbaren Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Beispielsweise werden die Ostländer ihre Landesverwaltungen noch schlanker und effizienter machen müssen. Zudem bieten mögliche Gebietsreformen Einsparpotenzial, ebenso wie engere Kooperationen zwischen den ostdeutschen Ländern. Beispiel: Warum jedes Bundesland ein eigenes Amt für Verfassungsschutz braucht, ist nicht zu vermitteln.
Jedoch: Die notwendigen Sparmaßnahmen werden nur dann durchsetzbar sein, wenn es gelingt, die Bevölkerung mitzunehmen: Alle Sparanstrengungen müssen mit dem übergeordneten Ziel verknüpft werden, aus Ostdeutschland eine Zukunftsregion zu machen. Zugleich müssen gewisse Gestaltungsspielräume bewahrt bleiben. Sparen nach der „Rasenmäher- Methode“ ist kontraproduktiv. Die Zauberformel lautet, Prioritäten zu setzen.
Auf welchen Feldern sollten wir die knapper werdenden Mittel einsetzen? In der Vergangenheit ist ein großer Teil der Investitionen in Infrastrukturprojekte geflossen. Zu Recht, auf diesem Gebiet war viel aufzuholen. Ohne gute Straßen und Schienen wäre der wirtschaftliche Aufholprozess zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber heute ist die Entwicklung der ostdeutschen Infrastruktur vielerorts weitgehend abgeschlossen. Selbstverständlich sind die begonnenen Infrastrukturprojekte wie die ICE- Neubaustrecke von Berlin über Erfurt nach München fertigzustellen. Und natürlich gibt es neue Infrastrukturvorhaben, die sinnvoll sind. Aber wir sollten uns auf neue Schwerpunkte konzentrieren. Wir brauchen die „zweite Welle Aufbau Ost“.
Auf der einen Seite sollten wir Innovationen intensiver fördern, denn noch immer geben unsere Unternehmen zu wenig Geld für Forschung und Entwicklung aus. Gerade in Thüringen sind viele kleine Firmen mit wenigen Mitarbeitern zuhause, die sich eigene Forschung nicht leisten können. Sie müssen sich untereinander stärker vernetzen und enger zusammenarbeiten. Thomas Kralinski, Chefredakteur der Zeitschrift Perspektive21, hat einen radikalen Vorschlag gemacht: Jeder Euro, der für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird, soll durch Steuergelder „veredelt“ werden. „Als verlängerte Werkbank hat der Osten in den kommenden Jahren keine Chance – und billiger geht es irgendwo anders immer.“ Auch wenn sein Modell wohl an der mangelnden Finanzierbarkeit scheitern würde, Kralinski legt den Finger in die Wunde: Dringend gesucht werden Anreizsysteme für mehr Forschung und Innovationen. Endlich müssen sich mehr große Forschungsinstitute in Ostdeutschland niederlassen. Darüber hinaus sollten wir zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um den Technologietransfer von Forschungseinrichtungen in die Unternehmen zu gewährleisten.
Auf der anderen Seite müssen die „weichen Faktoren“ stärker in den Fokus rücken: Kulturförderung, soziale Dienstleistungen, Personennahverkehr, Naherholung. Die „weichen“ Faktoren haben den vermeintlichen Nachteil, dass ihre sozio- ökonomische Bedeutung kaum messbar ist. Trotzdem können sie handfeste positive Wirkungen auf die Attraktivität einer Region für Menschen und Unternehmen haben – und damit auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Gerade weil sich in Ostdeutschland ein Fachkräftemangel abzeichnet, sollten wir alles dafür tun, die Lebensqualität weiter zu steigern, um potenzielle Neubürger und interessierte Unternehmen anzulocken.
Zugute kommt uns dabei, dass sich in den vergangenen Jahren ein neues, positives Heimatgefühl entwickelt hat, das gänzlich ohne „Ostalgie“ auskommt. Zum Ausdruck bringt es die Rock- Band „Kraftklub“ aus Chemnitz, die mit ihrem Hit „Ich will nicht nach Berlin“ die Charts stürmte. Oder nehmen wir das Projekt „3te Generation Ost“: Es handelt sich um einen Zusammenschluss jüngerer Ostdeutscher, die ihre besonderen Erfahrungen nutzen wollen, um die gesamtdeutsche Gesellschaft mitzugestalten. Das neue „Ostgefühl“ hat dazu beigetragen, dass unter den Ostdeutschen, die in den Westen gegangen sind, eine hohe Rückkehrbereitschaft existiert, sobald sich dort ähnlich viel Geld verdienen lässt wie im Westen. Einer aktuellen Studie des Leipziger Leibnitz- Instituts für Länderkunde zufolge sind heute etwa die Hälfte derjenigen, die von West- nach Ostdeutschland ziehen, Rückkehrer. Allein 2010 gingen mehr als 40.000 Ostdeutsche in ihre Heimat zurück. Und drei Viertel der ehemaligen Ostdeutschen können sich vorstellen, nach Hause zurückzukehren.
Darauf lässt sich aufbauen. Ein weiterer „weicher Faktor“ sind die ostdeutschen Kulturgüter: Kleine wie große kulturelle Einrichtungen – Museen, Theater, Musikclubs – können eine Strahlkraft entwickeln, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinausgeht. Im Idealfall wächst nicht nur die Tourismuswirtschaft, sondern auch die Attraktivität der gesamten Region. Leider liegt im ostdeutschen Kultursektor noch vieles im Argen. Kleinere Projekte der kreativen Szene kämpfen ums Überleben. Zugleich fehlt Geld, um die kulturhistorischen Juwelen Mitteldeutschlands angemessen auszustatten. Zwar sind für die Klassik Stiftung Weimar oder das Schloss Friedenstein in Gotha zusätzliche Bundesmittel geflossen. Dennoch ist noch viel zu tun. Und die ostdeutschen Bundesländer werden die benötigten zusätzlichen Mittel nicht alleine aufbringen können. Der Bund muss sich finanziell stärker engagieren, unter anderem seine Förderquote für die Klassik Stiftung Weimar erhöhen.
Womit wir beim grundsätzlichen Problem wären: Die meisten Länder sind strukturell unterfinanziert – in Ost wie West. Damit straucheln auch die Kommunen. Viele Gemeinden haben ihre kommunale Selbständigkeit verloren. Genau deshalb hat die SPD ein Finanzierungskonzept „Pakt für Bildung und Entschuldung“ beschlossen – solide durchgerechnet und politisch machbar. Damit Bund, Länder und Gemeinden mehr finanzielle Spielräume erhalten.
Mit unserem Finanzierungskonzept halten wir die grundgesetzliche Schuldenbremse strikt ein. Zugleich schaffen wir Spielräume für Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Das ist dringend notwendig, noch immer hängen in Deutschland die Lebenschancen zu sehr von der sozialen Herkunft ab. Um unsere Ziele zu erreichen, stärken wir die Länder und Gemeinden. Sie sollen mehr Mittel für Zukunftsausgaben zur Verfügung haben. Außerdem ist es absurd, dass es dem Bund per Grundgesetz verboten ist, Geld in Schulen und Universitäten zu investieren. Dass muss geändert werden.
Ziel ist es, den Ländern und Gemeinden zu helfen, die Gebühren für Kindertagesstätten sowie die Studiengebühren abzuschaffen, den flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschulen mit ausreichend Personal hinzubekommen und die Schulen und Universitäten auszubauen. Ferner sollen die Länder neue finanzielle Spielräume erhalten, indem die Vermögensteuer wieder eingeführt und die Erbschaftssteuer reformiert wird. Begründung: Seit zwei Jahrzehnten sinken die öffentlichen Vermögenswerte ab, während die des privaten Sektors wachsen. Laut aktuellem Armuts- und Reichtumsbericht ist das Nettovermögen des deutschen Staates zwischen 1992 und 2012 um über 800 Milliarden Euro zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich das Nettovermögen der privaten Haushalte von knapp 4,6 auf rund 10 Billionen Euro mehr als verdoppelt, wobei die reichsten zehn Prozent der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens verfügen.
Darüber hinaus wollen wir einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde einführen. Der Mindestlohn spült acht Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen in die Kassen – eine Maßnahme, die gerade im „Niedriglohnland“ Thüringen viele Arbeitnehmer deutlich besser stellen würde. 34 Prozent aller Thüringer Arbeitnehmer erhalten einen Stundenlohn unter 8,50 Euro. Viele von ihnen müssen sich ihren Lohn vom Staat aufstocken lassen. Damit handelt es sich um die größte deutsche Subvention.
Aber die schwarz- gelbe Bundesregierung tut das genaue Gegenteil von all dem. Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt die ostdeutschen Länder ausbluten. Der Vorsitzende der thüringischen CDU- Fraktion Mike Mohring will sogar unterschiedliche Einkommenssteuersätze für die Länder einführen. Die Folgen wären schlimm, denn Thüringen zählt zu den ärmeren Bundesländern. Wer hier lebt, müsste proportional mehr Steuern zahlen als ein Bayer. Und das, obwohl in Thüringen sowieso schon geringere Löhne gezahlt werden. Viele Menschen und Unternehmen würden den Freistaat verlassen. Warum Mohring den reichen Westländern in die Hände spielt, bleibt sein Geheimnis. Vergessen wir nicht, dass die rund 4 Millionen Ostdeutschen, die seit der Wende in den Westen gingen, zur dortigen Wirtschaftskraft erheblich beigetragen haben.
Fazit: Ostdeutschland hat in den vergangenen zwanzig Jahren viel erreicht. Auf dieser Substanz lässt sich aufbauen. Es wird darauf ankommen, kluge Einsparungen vorzunehmen, parallel zielgerichtet in Forschung und Innovationen sowie in die „weichen Faktoren“ zu investieren – und den Ländern und Gemeinden mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Äußerst kontraproduktiv sind alle Versuche, die Misere strukturschwacher Regionen als eine Auseinandersetzung Ost gegen West zu inszenieren, wie Oberbürgermeister aus dem Ruhrgebiet das in einer konzertierten Aktion im Mai 2012 versucht haben. Sondern alle ausgebluteten Länder, Städte und Gemeinden brauchen eine vernünftige Einnahmebasis. Deshalb sollten sich die Schwachen zusammentun und gemeinsam an den Stärkeren wenden: die schwarz- gelbe Bundesregierung. Die weniger finanzkräftigen Länder müssen enger zusammenarbeiten, übrigens auch bei den anstehenden Verhandlungen um den Länderfinanzausgleich. Sie müssen deutlich machen, dass Deutschland kein Land des Wettbewerbsföderalismus ist. Deutschland ist ein solidarischer Bundesstaat.
(c) Thüringer Allgemeine
Zur Diskussion um eine europäische Bankenaufsicht habe ich für das heutige Handelsblatt folgenden Beitrag verfasst:
Nach dem Brüsseler Gipfel im Juni verkündete der spanische Ministerpräsident Rajoy, in Not geratene Banken würden bald direkt von Europas Steuerzahlern finanziert. Die Bundeskanzlerin war düpiert. Noch am Vortag hatte ihre Koalition eine direkte Rekapitalisierung durch den ESM ausgeschlossen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein neuer Gipfel nun eine europaweite Bankenaufsicht hervorbringen. Merkel will, dass die EZB dauerhaft diese Aufgabe übernimmt. Die EZB versorgt den Bankensektor mit Liquidität – unbegrenzt. Als Aufsicht müsste sie Institute schließen, die den Anforderungen nicht entsprechen.
Der Interessenkonflikt ist programmiert, die EZB wäre nicht mehr unabhängig, sondern Teil des Spiels. Das Reputationsrisiko der EZB steigt, denn keine Finanzaufsicht ist unfehlbar. Die EZB wird angreifbar. Sie übernähme hoheitliche Aufgaben, aus denen sich eine Rechenschaftspflicht gegenüber Parlamenten und Regierungen zwingend ergibt. Über kurz oder lang führt dies zu einer Einschränkung ihrer Unabhängigkeit.
Zudem würde die EZB-Lösung den Binnenmarkt spalten: Die Nicht-Euro-Länder werden kein zweifelhaftes Modell unterstützen; es drohen unterschiedliche Normen und Aufsichtsstandards. Aus diesen Gründen darf die Bankenaufsicht in der EU höchstens vorübergehend für eine Aufbauphase von der EZB übernommen werden.
Bankenaufsicht allein ist ein stumpfes Schwert. Daneben ist eine aus Beiträgen der Banken finanzierte europäische Abwicklungseinrichtung nötig. Der ESM ist ein Rettungsschirm für Staaten. Er darf kein Bankenschirm werden, bei dem die Steuerzahler für die Fehler der Geldinstitute und der mangelhaften nationalen Aufsicht haften. Auch müssen Banken, bevor sie der Bankenunion beitreten, einen Stresstest absolvieren. Fällt eine Bank durch, muss eine Rekapitalisierung durch den Mitgliedstaat oder besser die Abwicklung der Bank erfolgen. Davor schreckt man sogar in Deutschland zurück. Auch in Spanien blieb die Ankündigung zur Abwicklung von Banken leer und die Gläubiger wurden ungenügend herangezogen – in der Hoffnung, dass der ESM bald übernimmt. Eine europäische Bankenaufsicht wäre dagegen von nationalen Interessen unabhängiger; Aufsichtsarbitrage bestenfalls nicht vorhanden. Außerdem wären mit einheitlichem Abwicklungsrecht die Staaten weniger erpressbar, Großbanken das Überleben zu sichern.
Von der Europäisierung der Bankrisiken profitieren vor allem Mitgliedstaaten mit großem Finanzsektor, Einige verweigern sich einer Finanztransaktionssteuer. Gleiche Regeln sollten aber nicht nur für die Regulierung des Finanzsektors, sondern auch für dessen Besteuerung gelten. Sonst drohen Wettbewerbsverzerrungen. Wer die Europäisierung der Risiken des Finanzsektors will, muss auch die Besteuerung harmonisieren.
Die Bankenunion darf kein Vehikel für die Sozialisierung der Bankverluste werden. Das Ziel einer langfristigen Lösung müssen Vertragsänderungen sowie die Gründung einer europäischen Bankenaufsichtsbehörde und einer Abwicklungsanstalt sein. Merkels Entscheidung, der EZB dauerhaft eine zentrale Rolle bei der Krisenlösung zu übertragen, ist ein Fehler. Sie ist die Totengräberin der Unabhängigkeit der Zentralbank.
(c) Handelsblatt