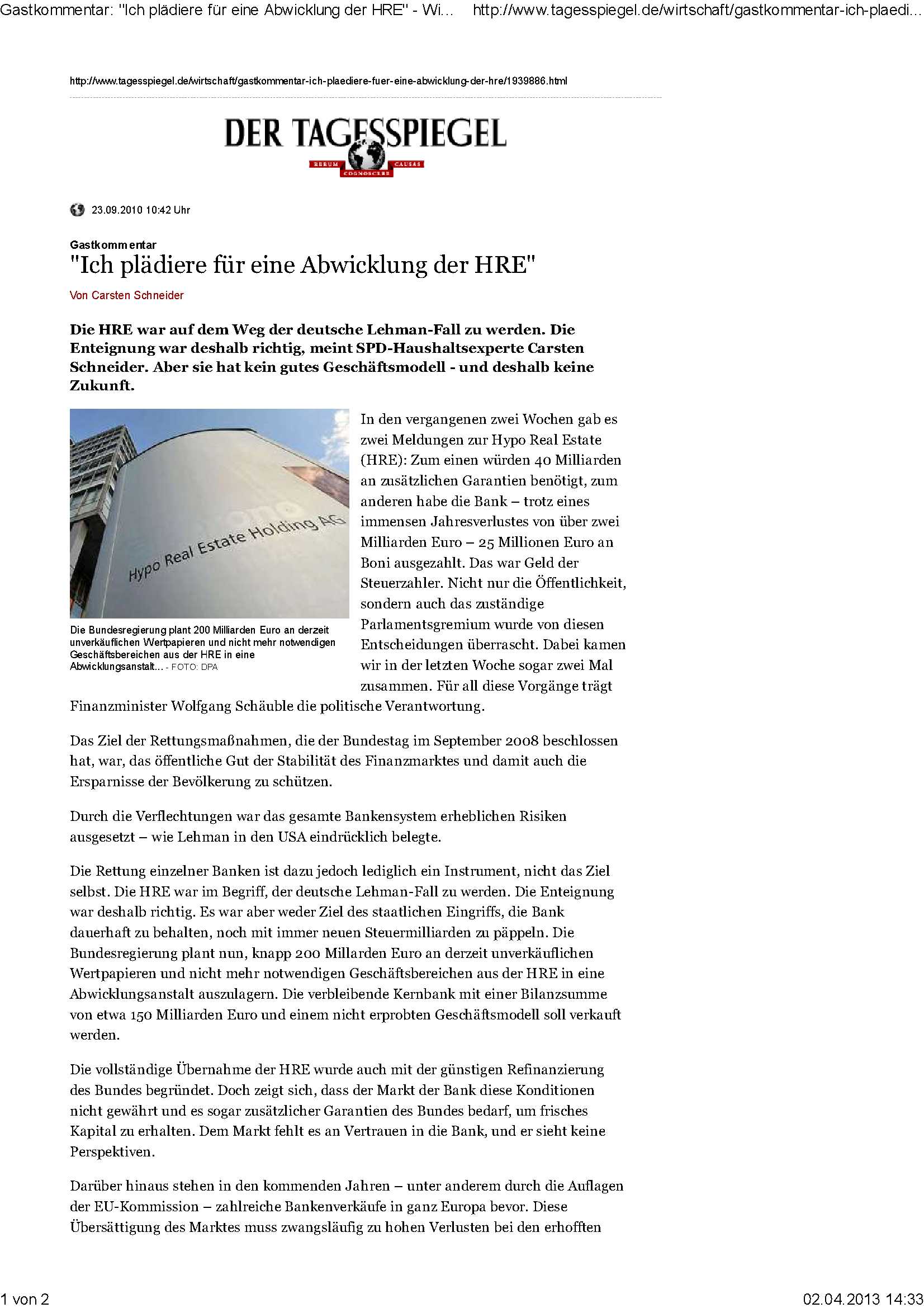Für die heutige Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Die größte weltanschauliche Gruppe in Deutschland sind mittlerweile die Konfessionsfreien: 34 Prozent der Bevölkerung gehören keiner Kirche an. In den vergangenen 20 Jahren sind pro Jahr im Durchschnitt rund 330 000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Auch die Quote der Taufen sinkt seit Jahrzehnten, ebenso die Zahl der Gottesdienstbesucher. Angesichts dieses Bedeutungsverlustes ist es beinahe paradox, wenn Vertreter von CDU/CSU in der Integrationsdebatte die angeblich „christlich-jüdische“ Prägung unseres Landes herausstreichen und die besonderen Rechtsbeziehungen zwischen Staat und großen Kirchen für sakrosankt erklären. Keinesfalls dürfe man das Staatskirchenrecht auf andere Religionsgemeinschaften übertragen, formuliert der CSU-Generalsekretär: „Ungleiches ist ungleich.“ Die Verfassungsväter hätten die Sonderstellung festgeschrieben, weil das „verfasste Christentum“ Wirtschaft und sozialen Zusammenhalt fördere.
Es sind verstörende Aussagen. Denn das Grundgesetz räumt in Artikel 140 allen Religionsgesellschaften ausdrücklich gleiche Rechte ein. Abgesehen davon, dass auch konfessionslose und andersgläubige Menschen einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Wie sehr unser Land von Vielfalt und neuen kulturellen Einflüssen profitieren kann, beweist die deutsche Nationalmannschaft in jedem Spiel aufs Neue. Doch Vielfalt wird nur dann zu einem Gewinn, wenn alle Bürger als Gleiche und mit Respekt voreinander am Gemeinwesen teilhaben können, unabhängig von Glaube und Herkunft. Dieses Grundprinzip einer liberalen Verfassungsordnung hat FDP-Generalsekretär Christian Lindner jüngst in einem klugen Artikel „Eine republikanische Offensive“ verteidigt. Verwirklicht wird es nur, wenn der Staat sich weltanschaulich neutral verhält und keine gesellschaftliche Gruppe bevorzugt oder benachteiligt.
Von diesem Modell ist Deutschland weit entfernt. Zum einen müssen wir offener werden gegenüber anderen Konfessionen, etwa wenn es um ihre Rechte als Religionsgemeinschaften oder um religiöse Bekundungen in der Öffentlichkeit geht. Zum anderen gilt es, die vielen Vorrechte der großen Kirchen zu überprüfen. Das beginnt beim Religionsunterricht, der in den meisten Bundesländern ein versetzungsrelevantes Lehrfach darstellt. Zuständig für die Inhalte sind die Kirchen, die dafür ihre Dogmen zugrunde legen. Zeitgemäß wäre es, den „Bekenntnisunterricht“ durch einen gemeinsamen Unterricht aller Schüler in den weltanschaulichen Grundlagen unserer Kultur zu ersetzen. Unangemessen ist auch die staatlich subventionierte Priesterausbildung: Warum sollen die Bürger, von denen 70 Prozent keine Katholiken sind, katholisch-theologische Fakultäten bezahlen? Und wieso haben die Kirchen Einfluss auf die Besetzung von Professuren, die mit Steuergeld finanziert werden?
Hinzu kommen die direkten finanziellen Verquickungen zwischen Kirche und Staat. Von der Kirchensteuer einmal abgesehen, kommt der Steuerzahler für staatliche Alimente an die großen Kirchen auf – Entschädigungen für ehemaligen Kirchenbesitz, der in Staatsvermögen überging. Mehr als 200 Jahre liegt der Reichsdeputationshauptschluss mittlerweile zurück. Doch immer noch zahlen die Länder Dotationen in Höhe von derzeit 460 Millionen Euro jährlich für kirchliche Verwaltungskosten, Besoldung und die Versorgung von Geistlichen. Der Bund sollte endlich seinen grundgesetzlichen Auftrag aus Artikel 140 erfüllen und die Regeln für die Ablösung der Dotationen festlegen.
Die Liste dieser exklusiven Verbindungen ließe sich fortsetzen. Umgekehrt gibt es Bereiche, in denen der staatliche Einfluss auf die Kirchen zunehmen muss. Beispiel Arbeitsrecht: Alle Wohlfahrtsverbände – kirchliche wie nichtkirchliche – finanzieren sich zum größten Teil über „Leistungsentgelte“, sprich: über Gelder aus der Sozialhilfe sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Gleichzeitig nehmen die kirchlichen Organisationen für sich in Anspruch, ihre Mitarbeiter nach Religionszugehörigkeit auszuwählen – nicht nur leitende Angestellte, sondern auch Sachbearbeiter oder Erzieherinnen. Caritas und Diakonie berufen sich auf das „kirchliche Selbstverwaltungsrecht“ und den „Verkündungsauftrag der Kirche“. So schaffen sie eine doppelte Ungerechtigkeit: Erstens diskriminieren sie nichtchristliche Arbeitsuchende, zweitens finanzieren auch konfessionsfreie oder andersgläubige Steuer- und Beitragszahler die Verbreitung des christlichen Glaubens mit.
Es gibt keine Alternative: Um des sozialen Friedens willen muss das Verhältnis von Staat und Kirche neu ausbalanciert werden. Doch viel zu oft wird versucht, diese Diskussion schon im Keim zu ersticken. Dabei schaffen es auch andere gemeinnützige Organisationen, ohne staatliche Privilegien zu existieren – indem sie konsequent daran arbeiten, mehr Menschen für ihre Anliegen zu begeistern. So gesehen, könnte eine striktere Trennung von Kirche und Staat für die christlichen Kirchen eine Chance sein: als Anstoß für innerkirchliche Reformen.
(c) Frankfurter Allgemeine Zeitung