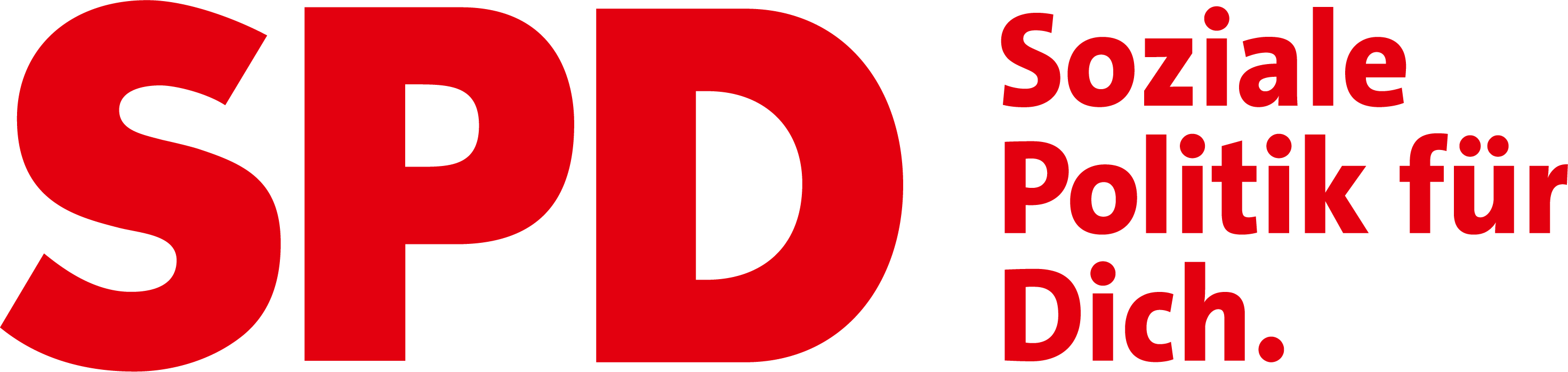Ostdeutschland 2020 – Die Zukunft des „Aufbau Ost“ lautet der Titel einer Studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde und die das Landesbüro Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben hatte:
Nach wie vor hat Ostdeutschland die gleichen Probleme: Die Wirtschaftskraft liegt bei 70 Prozent des westdeutschen Niveaus, die Arbeitslosenquote ist mit rund 12 Prozent weiterhin fast doppelt so hoch und die Löhne liegen teilweise deutlich unter Westniveau.
Besonders in den niedrigen Löhnen sehe ich einen entscheidenden Standortnachteil für den Osten. Klar ist deshalb: Die Löhne müssen steigen, um vor allem Fachkräfte zu halten und auch anwerben zu können. In einigen Branchen herrscht bereits ein erheblicher Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Ostdeutsche Unternehmen werden Lohnanreize setzen müssen.
Außerdem muss der Bund mehr in Forschung und Entwicklung im Osten investieren und die dortige wissenschaftliche Infrastruktur ausbauen. Innovationen lösen wirtschaftliche Impulse aus und setzen dadurch positive Entwicklungen in Gang.
Einen Aspekt, den die Studie nicht beleuchtet, ist der Kulturreichtum. Auch er prägt das Image Ostdeutschlands und übt eine Anziehungskraft aus. Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass der Bund eine größere finanzielle Verantwortung zur Förderung des kulturellen Erbes übernimmt.
Dies sind einige der Forderungen, die ich im Rahmen meiner Kommentierung der Studienergebnisse aufgestellt habe. Die komplette Studie ist hier als Download verfügbar.
Interview in mdr aktuell vom 24. Mai 2012 im Wortlaut:
Christoph Sagurna: Herr Schneider, die Studie, die uns hier gerade von den Autoren der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, sagt im Groben, dass die Lebensverhältnissen in Ost und West noch eine ganze Weile – wenn nicht sogar für immer – unterschiedlich bleiben. Überrascht Sie das Ergebnis?
Carsten Schneider: Nein, das Ergebnis überrascht mich nicht. Denn es gibt sowohl im Westen wie im Osten unterschiedlich wachsende Regionen und unterschiedlich starke Regionen. Also der Gesamtschnitt ist immer einer, der nie die gesamte Wahrheit abbildet, und wir haben einfach in Ostdeutschland die Situation, dass uns die großen Unternehmen mit ihren Hauptsitzen fehlen und deswegen eben auch die Steuerkraft, die Arbeitsplätze und die Innovationsfähigkeit. Das ist das Hauptmanko, was einer Angleichung letztendlich im Wege steht und was wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird.
Sagurna: Wenn ich die Studie richtig verstanden habe, zucken die Wissenschaftler ja mit den Schultern und sagen, da kann man nichts machen, das ist halt so. Während die Politik in der Pflicht ist, verfassungsgemäß schon in der Pflicht ist, die Lebensverhältnisse anzugleichen. Was kann die Politik tun, um dieser Studie mittelfristig zu wiedersprechen?
Schneider: Zwei Punkte sind notwendig. Erstens wir brauchen in den ostdeutschen Bundesländern auch in den nächsten Jahre eine Finanzausstattung für die Kommunen aber auch für die Länder, dass sie ihre Aufgaben finanzieren können: öffentliche Sicherheit, Bildung, Kindergärten und Hochschulen. Das heißt, ein neuer Länderfinanzausgleich muss diese Finanzkraft sicherstellen.
Der zweite Punkt ist: Was tut man noch zusätzlich, damit die Regionen in Ostdeutschland prosperieren, dass sie wachsen können? Und das ist vor allen Dingen die Frage nach Investitionen, Geld vom Bund für die Wissenschaft, für neue Großforschungseinrichtungen und -zentren, die leuchten dann letztendlich auch wieder machen Städte attraktiv machen. Und vor allem führen sie dazu, dass aus den Erkenntnissen irgendwann auch einmal Arbeitsplätze werden. Das fehlt bisher total in der Strategie der Bundesregierung und deswegen meine ich, muss das berücksichtigt werden.
Sagurna: Jetzt habe ich gerade vor meinem geistigen Augen zum Beispiel den Oberbürgermeister von Oberhausen gesehen, wie er sagt: Oh, Länderfinanzausgleich zugunsten der Ost-Kommunen und Länder. Noch mehr Geldtransfer West-Ost. Würden Sie diesem Klagegrund etwas entgegenhalten können?
Schneider: Also der Länderfinanzausgleich ist ja befristet bis 2019. Er muss neu geordnet werden. Und die ostdeutschen Länder sind sogar benachteiligt, weil die Finanzkraft – was die Städte und Gemeinden an Geld einnehmen – nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt wird. Es wird bei der Neuordnung oder Neuverhandlung dann auch darum gehen, dass man auch demografische Lasten ausgleicht, nicht so sehr Ost-West, sondern wirklich gesamtdeutsch einen Ausgleich der Finanzkraft hinbekommt. So dass wir überall lebenswerte Regionen haben.
Sagurna: Das habe ich eben schon aus Ihrer Antwort gehört und mich gefragt: Ist es denn überhaupt sinnvoll heutzutage noch genau diese Ost-West-Frage bei den Lebensverhältnissen zu stellen oder müsste die Differenzierung nicht eine ganz andere sein, um nicht auch eine moralische Schieflage zu erzeugen, die gar nicht gerechtfertigt ist? Sie selber haben ja von dem Durchschnitt gesprochen.
Schneider: Ja also, klar ist der Solidarpakt II gilt jetzt bis 2019. Das muss auch sein. Danach wird es nicht mehr nach Himmelsrichtungen gehen, ob das nun im Osten oder im Westen eine Stadt ist oder ein Land, sondern es wird darum gehen, wie der Bedarf ist. Da wird es Allianzen zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht Sachsen und Bayern geben. Das muss man dann sehen. Es wird dann eher wirklich darum gehen: Wie ist die Situation und wie können überall die Menschen halbwegs ordentlich leben.
Sagurna: Kommunalfinanzen ist ein schwieriges Thema und sicherlich zu schwierig, um es in einer Antwort zu erklären. Aber vielleicht noch mal das Beispiel, was Sie eben auf dem Podium in den Mund genommen haben. Es gibt Oberhausen, es gibt Duisburg, es gibt aber auch Bonn, es gibt Dresden, es gibt aber auch sächsisches Land, wo die Kommunen sehr viel schlechter in der Einnahmesituation dastehen. Wieso ist das falsch berücksichtigt, wenn es um den Länderfinanzausgleich geht, der neu geordnet werden muss? Wenn Sie das an einem Beispiel noch einmal versuchen könnten zu erklären.
Schneider: Also der Länderfinanzausgleich gleicht die Steuereinnahmen in etwa aus. Bei den Kommunen, bei den Städten ist es aber so, dass sie Gewerbesteuereinnahmen haben, die auch Teil der Länderfinanzen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen, die in Stuttgart natürlich wegen Daimler und Porsche viel höher sind als vielleicht in Leipzig, die werden nur zu zwei Dritteln einberechnet. Das heißt, tatsächlich ist der Osten dadurch benachteiligt, weil wir nicht so viel Gewerbesteuereinnahmen haben und deswegen der Ausgleich nicht so hoch ist, wie er eigentlich sein müsste.
Sagurna: Ganz zum Schluss, das habe ich eben Dr. Ragnitz auch gefragt: Die Definition von Lebensverhältnissen wird ja in dieser Studie rein an den ökonomischen Lebensverhältnissen bemessen. Wie viel Geld ist im Portemonnaie. Ist das überhaupt eine relevante Definition? Wenn ich daran denke, dass Menschen ihr lebensglück nicht unbedingt ausschließlich übers Portemonnaie definieren. In anderen Worten: Wenn jetzt jemand in Ostdeutschland die Ergebnisse dieser Studie sieht, oh Gott wir sind immer noch so viel hinterher und es wir noch so ewig lange dauern. Wird der nicht allein unglücklich durch das Lesen der Studie, obwohl er gar nicht so unglücklich sein müsste?
Schneider: Erstens gibt es in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt eine große Heimatverbundenheit der Menschen. Die wollen lieber zu Hause bei sich in ihren Regionen bleiben und dort auch leben und arbeiten als wegzugehen. Aber der entscheidende Punkt ist der Lohn. Und wenn die Löhne weiterhin deutlich niedriger sind als in Stuttgart oder München oder eben auch in Oldenburg, dann wird es eher einen Verlust von Menschen geben, weil sie abwandern werden. Und wir brauchen sie alle hier und deswegen ist Geld schon ein Aspekt, nicht der entscheidende, aber die Löhne in Ostdeutschland müssen steigen.
Sagurna: Allerletzte Frage, auch das etwas aufgegriffen aus Ihrer Antwort eben. Dem Bund sind häufig die Hände gebunden: Kooperationsverbot ist ein Beispiel. Sie fordern einen stärkeren Bund bei der Hilfe, die Lebensumstände anzugleichen. Wie könnte das aussehen?
Schneider: Also der Bund ist qua Gesetz in vielen Punkten nicht berechtigt, den ostdeutschen Ländern zu helfen. Zum Beispiel zu sagen, die Klassikstiftung Weimar oder die Universität Dresden übernehmen wir in unsere Verantwortung, wenn das Land das auch möchte. Ich finde, das muss aber möglich sein, so eine Art von Experimentierklausel, dass der Bund stärker Verantwortung auch für sein Erbe, historisches Erbe übernimmt. Und dann letztendlich diese Einrichtungen mit finanziert, die Länder entlastet und sie auch zum Blühen bringt. Diese Experimentierklausel ist zwingend notwendig.
Sagurna: Ist das bei diesen starren föderalen Strukturen, die wir haben, überhaupt denkbar? Ist das möglich so eine Ausnahmeregelung?
Schneider: Gesetzlich ist das möglich, man muss das Gesetz letztendlich ändern. Und ich hoffe, das wir für so etwas auch eine aktive Mehrheit bekommen.
Sagurna: Ich danke vielmals für das Gespräch
 Am gestrigen Donnerstag war ich zusammen mit Peer Steinbrück Redner auf dem Innovationsdialog „Zukunft der Finanzmärkte“ in Berlin – eine Veranstaltung der von mir mit herausgegebenen Zeitschrift „Berliner Republik“. Auf dem anschließenden Podium saßen zudem Theodor Weimar, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Deutschland AG, und der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Georg Fahrenschon.
Am gestrigen Donnerstag war ich zusammen mit Peer Steinbrück Redner auf dem Innovationsdialog „Zukunft der Finanzmärkte“ in Berlin – eine Veranstaltung der von mir mit herausgegebenen Zeitschrift „Berliner Republik“. Auf dem anschließenden Podium saßen zudem Theodor Weimar, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Deutschland AG, und der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Georg Fahrenschon.