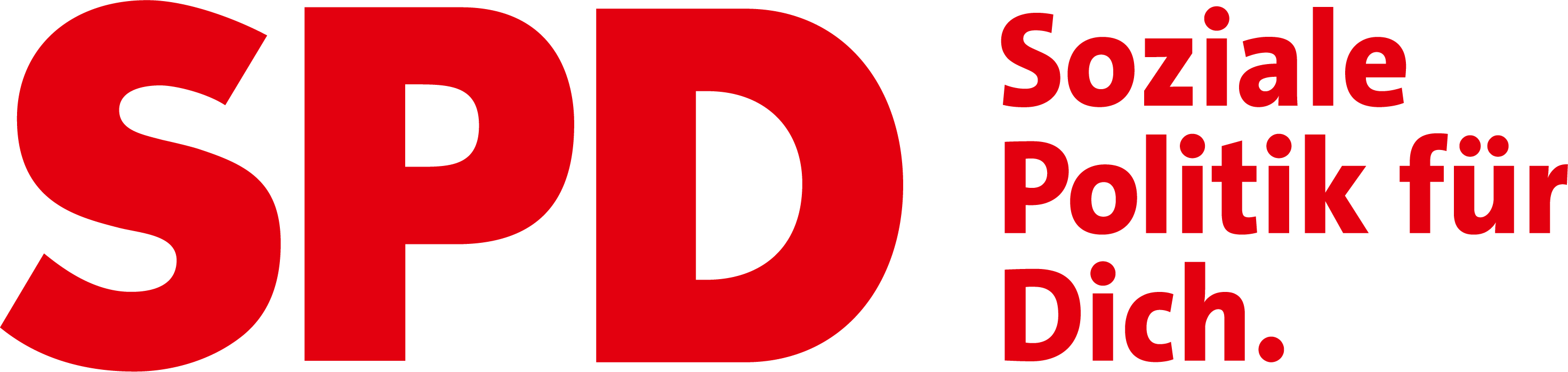In der heutigen Thüringer Allgemeinen gebe ich ein Interview zu den Euro-Thesen von Thilo Sarrazin und meine Sicht auf den Staat und die Finanzmärkte. Hier geht es zur Onlineausgabe.
Heute hat die SPD ihre Forderungen für einen europäischen Wachstumspakt vorgestellt. Neben einem Wachstums- und Beschäftigungsprogramm sowie einem Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit sind auch Maßnahmen enthalten, die Finanzmarkt- und Bankenkrise wirksam zu bekämpfen. Das komplette Positionspapier finden Sie hier.
Der Kommentar „Abbruch West“ von Bernd Dörries in der Süddeutschen Zeitung vom 20. März 2012 ist ein Ärgernis. Dörries gibt vor, mutig ein Tabu zu brechen. Das angebliche Tabu lautet, am Aufbau Ost dürfe nicht gerüttelt werden. Doch ein solches Tabu gibt es gar nicht. Der Solidarpakt II ist in Wirklichkeit streng regressiv gestaltet, das heißt, von Jahr zu Jahr nehmen die Zuweisungen an die ostdeutschen Bundesländer ab. Im Jahr 2012 fließen nur noch 68 Prozent der Summe aus dem Ausgangsjahr 2005 und im Jahr 2020 fließt gar kein Geld mehr. Entsprechend hart sind bereits jetzt die Einschnitte, die die ostdeutschen Länder in ihren Haushalten von Jahr zu Jahr einplanen müssen.
Dörries suggeriert, westdeutsche Städte seien deshalb hoch verschuldet, weil sie ihren Anteil am Solidarpakt zugunsten ostdeutscher Städte aufzubringen hätten. Aber nicht Saalfeld, Rudolstadt oder Weimar sind schuld an der Finanzkrise von Essen, Oberhausen oder Gelsenkirchen. Die Verschuldung westdeutscher Kommunen hat ganz unterschiedliche Gründe: den unbewältigten Strukturwandel weg von der Schwerindustrie, hohe Arbeitslosigkeit, fehlende Steuereinnahmen etwa aus der Gewerbesteuer – aber ganz sicher auch sorgloses Wirtschaften in Vergangenheit und Gegenwart. Aus diesen Gründen gibt es – nicht nur im Ruhrgebiet – Kommunen, die vollständig überschuldet sind und ihrer Schuldenmisere aus eigener Kraft objektiv nicht mehr Herr werden können.
Es ergibt keinen vernünftigen Sinn, die Misere strukturell benachteiligter Regionen in Deutschland als Auseinandersetzung Ost gegen West zu inszenieren. Vielmehr muss es darum gehen, allen in den vergangenen Jahren ausgebluteten Städten und Kommunen eine vernünftige Einnahmebasis zu gewähren, damit auch hoch verschuldete Städte in strukturschwachen Regionen Westdeutschlands wieder ausgeglichene Haushalte erreichen können.
Der richtige Adressat für die Sorgen der verschuldeten Ruhrgebietsstädte muss deshalb die Bundesregierung sein. Pflicht der Regierung Merkel wäre es, den Kommunen angemessene Steuereinnahmen zu ermöglichen. Stattdessen hat die Regierung Merkel die Programme der Städtebauförderung, von denen der Westen profitiert, um durchschnittlich 26 Prozent in diesem Jahr im Vergleich zu 2011 gekürzt. Am stärksten hat es den „Stadtumbau West“ getroffen, der um 50 Prozent zusammengestrichen wurde. Die SPD hingegen hat jüngst ein Finanzkonzept vorgelegt, dass eine Verbesserung der Einnahmesituation der Kommunen vorsieht. In ihrem „Pakt für Bildung und Entschuldung“ will die SPD eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen unter anderem durch eine höhere Besteuerung höherer Einkommen und Vermögen finanzieren.
Davon abgesehen ist es allein Sache der Bundesländer, wie sie ihre innere Finanzverteilung regeln. Jedes einzelne westdeutsche Land hätte die Möglichkeit, finanziell besonders belasteten Kommunen durch Änderungen des landesinternen kommunalen Finanzausgleichs zu helfen.
Ich habe großes Verständnis für die westdeutschen Städte, die finanziell in tiefen Schwierigkeiten stecken. Aber es ist Unsinn, in dieser Frage die Schwachen gegeneinander auszuspielen. Wir waren in dieser Debatte schon einmal weiter.
Über dieses Thema diskutierte ich heute mit einer Gruppe von örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmern in Arnstadt.
Dabei habe ich deutlich gemacht, worin ich den Kardinalfehler der Hauptverantwortlichen sehe, der zu dem jetzigen Ausmaß der Krise geführt hat: Bereits im Dezember 2009 war die desolate Lage, in der Griechenland steckte klar sichtbar geworden. Hätten die Staats- und Regierungschef der Euro-Zone damals schnell und mutig reagiert und einig und solidarisch hinter Griechenland gestanden, hätte sich die Schuldenkrise nicht auf Länder wie Irland, Portugal, Spanien oder Italien ausgeweitet.
Leider herrschte Uneinigkeit – sowohl innerhalb der deutschen Bundesregierung, die sich wochenlang nicht zu einer Entscheidung durchringen konnte, als auch zwischen den Euro-Ländern. Vernünftigerweise ist doch aber klar, dass Staaten, die eine gemeinsame Währung teilen und sich damit in gegenseitige Abhängigkeiten begeben, nicht einfach Wirtschafts- und Finanzpolitik nach eigenem nationalen Gutdünken betreiben können!
Meine Lösung heißt also ganz einfach: „Mehr Europa!“
Das bedeutet, dass die Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die Europäische Union abgeben müssen. Einhergehen muss damit selbstverständlich eine Demokratisierung und stärkere Legitimierung der europäischen Institutionen. Das bedeutet aber auch: mehr Integration und Verflechtung der Nationalstaaten auf europäischer Ebene, um eine bessere Abstimmung koordinieren zu können.
Über die angeregte Diskussion mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen habe ich mich sehr gefreut. Ich komme gerne wieder!
Heute Abend hatte ich dank einer Einladung des Thüringer Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung die Möglichkeit, das neue Steuer- und Finanzkonzept der SPD vorzustellen und anschließend mit dem Leiter des ver.di Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Thomas Voß sowie einem großen Publikum darüber zu diskutieren. Klar wurde, dass die SPD einen ökonomisch sinnvollen und vernünftigen Plan mit einer deutlichen politisch-sozialen Ausrichtung vorgelegt hat.
Angesichts der desolaten finanziellen Situation, in der sich die Euro-Länder momentan aufgrund ihrer Schuldenlast von durchschnittlich 87 % befinden, stellen sich für eine große Volkswirtschaft wie Deutschland zwei Fragen: Erstens, was wollen wir uns leisten? Und zweitens, wo bekommen wir die Mittel zur Finanzierung her?
Das Steuer- und Finanzkonzept der SPD gibt hierauf klare Antworten: Unsere Prioritäten beziehen sich auf den Ausbau und die Verbesserung der staatlichen Bildungsangebote, die Erhöhung der Finanzkraft der Kommunen und auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und in die Energiewende. Hierin sehen wir die Zukunft.
Zur Finanzierung dieser Investitionen setzen wir auf gezielte Steuererhöhungen sowie Subventionsabbau, um gleichzeitig die Lasten, die diese Gesellschaft tragen muss, wieder sozial gerechter zu verteilen. Wir fordern daher insbesondere eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 % bei einem Jahreseinkommen von 64 000 Euro – das beträfe in Thüringen nicht mehr als 0,05 % der Bevölkerung. Neben einer Anhebung der Abgeltungssteuer, der Brennelementesteuer, der Wiedereinführung der Vermögenssteuer, der Rücknahme der Begünstigungen für Hoteliers sowie der Abschaffung des Ehegattensplittings sieht das Konzept die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns von 8.50 Euro vor. Der Mindestlohn würde vielen Bürgerinnen und Bürgern vor allem Ostdeutschlands endlich ein würdiges und gerechtes Einkommen ermöglichen – könnte aber gleichzeitig auch durch eine erhöhte Nachfrage die Wirtschaft ankurbeln. Für am wichtigsten halte ich allerdings die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die diejenigen an der Finanzierung der Staatsleistungen beteiligt, die zur Zeit stark von ihnen profitieren. Schon ein sehr niedriger Steuersatz würde die Staatseinnahmen um ein Vielfaches verbessern. Dies ist zur Konsolidierung der Haushalte, die stark unter den Bankenrettungen der vergangenen Jahre gelitten hat, unerlässlich.
Im Bereich des Subventionsabbaus setzt die SPD auf die Beseitigung ökologisch schädlicher Subventionen, auf eine Verwaltungsmodernisierung sowie die Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Boni und Managergehältern.
Die SPD ist mit ihrem Konzept wieder klar auf dem Kurs der Gewerkschaften – viele unserer Forderungen überschneiden sich. Insbesondere sind wir die einzige Partei, deren finanzpolitisches Konzept wieder sowohl auf die Ausgaben- als auch auf die Einnahmeseite guckt. Wir wollen damit die Fehler der schwarz-gelben Koalition von Angela Merkel und Philipp Rösler korrigieren, die die Staatseinnahmen durch Steuergeschenke völlig zunichte machen und auf der Ausgabenseite sozial ungerechte Prioritäten setzen. Dies ist nicht weiter hinnehmbar!
Ich danke der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Organisation dieser angeregten Diskussion mit Herrn Voß und Erfurter Bürgerinnen und Bürgern.
Schwarz-Gelb hat die noch junge Schuldenregel im Grundgesetz bereits ausgehöhlt, bevor sie vollständig in Kraft tritt. Zudem ist der EU-Fiskalvertrag zu unverbindlich
von Carsten Schneider
Am heutigen Donnerstag unterschreibt die Bundeskanzlerin beim Europäischen Rat den sogenannten Fiskalvertrag. In diesem Vertrag verpflichten sich die unterzeichnenden EU-Mitgliedsstaaten, in ihre Verfassungen binnen zwei Jahren Schuldenregeln aufzunehmen.
In Deutschland lässt sich die Kanzlerin gern für diese harte europapolitische Konsolidierungspolitik feiern. Tatsächlich braucht sie den Vertrag vor allem auch als Pappkameraden zur Beruhigung ihrer Fraktion, um für die undurchsichtige Politik ihrer Regierung überhaupt noch Mehrheiten zu bekommen. Wie wir seit Montag wissen, klappt das dennoch nur bedingt.
Viele Abgeordnete der schwarzgelben Koalition haben mittlerweile erkannt, dass der Pappkamerad in Wirklichkeit ein zahnloser Tiger ist: Die darin enthaltenen neuen Pflichten haben bei Weitem nicht dieselbe Verbindlichkeit wie das europäische Gemeinschaftsrecht. Eine effektive Konsolidierungspolitik in der gesamten Euro-Zone lässt sich so kaum durchsetzen. Besonders frappierend: Während die Kanzlerin in Europa eifrig Wasser predigt, säuft sie zu Hause Wein. Die Regierung hat die noch junge Schuldenregel im Grundgesetz bereits ausgehöhlt, bevor sie vollständig in Kraft tritt.
Ab dem Jahr 2016 ist der Spielraum für die strukturelle Neuverschuldung des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Bis dahin ist im Grundgesetz ein Übergangszeitraum vorgesehen. Vom Jahr 2011 soll das strukturelle Defizit des Bundes in gleichmäßigen Schritten bis zu dieser neuen Obergrenze hin abgebaut werden. Der Ausgangspunkt für diesen Abbaupfad war 2010 festzustellen.
Durch eiskalte Trickserei haben Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble das strukturelle Defizit im Jahr 2010 auf rund 53 Mrd. Euro festgelegt, obwohl es bei korrekter Anwendung nur 32 Mrd. Euro betragen hätte. In der Folge entsteht ein steilerer Abbaupfad und in den ersten Jahren ein größerer Verschuldungsspielraum – dabei handelt es sich um die Jahre bis zum regulären Wahltermin 2013.
Allerdings: Aufgrund der guten konjunkturellen Lage konnte der Bundeshaushalt im vergangenen Jahr mit weniger neuen Schulden auskommen.
Die Differenz – also die nicht genutzten Verschuldungsspielräume bleibt der Regierungskoalition aber erhalten und wird ausgerechnet heute auf das Kontrollkonto der Schuldenbremse gebucht.
Dieses Kontrollkonto wird als Gedächtnis der Schuldenbremse bezeichnet. Dieser Vorgang, mit dem sich der Finanzminister einen großzügigen Dispo in Höhe von 25,5 Mrd. Euro einräumt, wird sich in den kommenden Jahren wiederholen. So laufen nach Berechnungen der Bundesbank bis 2016 zusätzliche Verschuldungsspielräume von insgesamt mindestens 50 Mrd. Euro auf. Diese Kriegskasse kann die Bundesregierung für ihren Haushaltsvollzug nutzen und vor der nächsten Wahl teure Klientelgeschenke und Steuersenkungen finanzieren.
Einen Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion zur Korrektur dieser Verschuldungsspielräume, der inhaltlich auch vom Sachverständigenrat, der Bundesbank und dem Bundesrechnungshof unterstützt wurde, hat die schwarz-gelbe Mehrheit im letzten Jahr abgelehnt.
Die Bundeskanzlerin und ihre Koalition dehnen die Verfassung, um sich einen parteitaktischen Vorteil zu verschaffen. Dass sie damit nicht nur beim deutschen Steuerzahler, sondern auch in Europa Vertrauen zerstören, nimmt Schwarz-Gelb billigend hin.
Im Klartext: Wenn die Bundeskanzlerin heute ihre Unterschrift unter den neuen Fiskalvertrag setzt, hat sie bereits selbst dagegen verstoßen.
Carsten Schneider ist haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Der Artikel ist in der Financial Times Deutschland am 1. März 2012 erschienen.
Noch immer verzichten 75 Prozent der Väter auf die Elternzeit. Gleichzeitig geben in Umfragen viele Männer an, sich mehr Zeit für ihre Familie zu wünschen. Wie steht es also um die Arbeitsteilung in der Familie und den Wandel der Rollenbilder – fünf Jahre nach Einführung des Elterngeldes? Darüber diskutierte ich heute auf der Veranstaltung „Vater Morgana“ in der Friedrich-Ebert-Stiftung.
In meinem Vortrag wies ich zunächst auf die erzielten Fortschritte durch sozialdemokratische Familienpolitik hin: Elterngeld, Kita-Ausbau, Teilzeitgesetz, Ganztagsschulprogramm. Dennoch stehen noch immer einige Faktoren einer wirklichen Gleichberechtigung entgegen: Erstens prägt unsere Unternehmens- und Arbeitskultur ein bestimmtes Bild vom richtigen Leben auf der Karriereleiter: Anwesenheit ist immer noch eine Tugend – trotz moderner Kommunikationstechnologie, Unterbrechungen der Erwerbsbiografien sind Karrierehindernisse, Zeitsouveränität ist in vielen Betrieben ein Fremdwort. Zweitens haben viele junge Familien Angst vor der Arbeitslosigkeit: In stürmischen Zeiten soll sich wenigstens ein Elternteil mit voller Energie dem Beruf widmen und die Familie finanziell absichern. Dass diese Rolle fast immer der Mann übernimmt, liegt nicht zuletzt an den immer noch niedrigeren Gehältern der Frauen. Drittens ist unser Sozial- und Steuersystem auf den männlichen Alleinernährer ausgerichtet. Wer die Erwerbsarbeit auf beide Partner verteilen will, wird vom Staat bestraft. Erst vor zwei Wochen stellte die OECD Deutschland beim Thema Beteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ein miserables Zeugnis aus. In ganz Europa ist vom „Modell Deutschland“ die Rede. Was Familien- und Gleichstellungspolitik angeht, sind wir definitiv kein Modell!
Auf all diesen Gebieten bleibt also noch viel zu tun. Und gerade die SPD kann dabei politisch viel gewinnen – und viel verlieren. Erinnern wir uns: Bei den letzten Wahlen haben sich gerade auch die Jüngeren von der SPD abgewandt, insbesondere die jüngeren Frauen. Nur wenn wir Konzepte haben, wie wir Deutschland zu einem familienfreundlicheren Land machen wollen, können wir wieder Mehrheiten gewinnen. So wollen wir das Ehegattensplitting abschaffen, um Arbeit für Frauen attraktiver zu machen. Zudem müssen wir flexiblen Lebensläufen stärker Rechnung tragen, etwa indem wir Halbtagsstellen im Sozialversicherungssystem aufwerten. Auch müssen wir die Elternzeit so weiterentwickeln, dass die Chancengleichheit von Männern und Frauen verbessert wird.
Im Anschluss an mein Referat stellte Svenja Pfahl vom Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer eine neue Studie über das Elterngeld vor. Ihr Zwischenfazit nach fünf Jahren Elterngeld: Der Anteil der Väter, die diese Leistung in Anspruch nehmen, steigt beständig. Und viele Väter beteiligen sich hinterher stärker an Kinderbetreuung und Familienaufgaben und bringen ihren Partnerinnen und weiblichen Kolleginnen mehr Verständnis und Achtung entgegen. Auch ist die anschließende Rückkehr in den Beruf für die meisten ein positives Erlebnis: 85 Prozent geben an, ihre berufliche Situation sei unverändert geblieben. Nur 16 Prozent schätzen, nun geringere Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. Laut Svenja Pfahls hat das gesetzlich festgeschriebene Elterngeld eine „umfassende normative Wirkung“ auf unsere Arbeitskultur.
Unterm Strich ist das Elterngeld also ein voller Erfolg. Aber wie wird es sich weiterentwickeln? Beispielsweise kritisierte Thomas Lindemann, Feuilletonredakteur bei der Welt, das „Standardmodell“ sei unzureichend. In den meisten Fällen nehme die Frau 12 Monate Elternzeit und der Mann nur 2 Partnermonate. Um die Anreize zu erhöhen, die Elternzeit gleichberechtigter zu verteilen, steht in der SPD unter anderem das Drittelmodell zur Debatte: Ein Drittel der Elternzeit wäre für die Mutter vorgesehen, ein Drittel für den Vater, ein Drittel wäre frei wählbar. Darüber hinaus muss die Politik bessere Bedingungen für die Kombination des Elterngeldes mit Teilzeitarbeit schaffen. Wenn wir dafür sorgen, dass mehr Männer das Elterngeld länger in Anspruch nehmen, kann es noch mehr zu einem „Türöffner“ (Sonja Pfahl) werden für familienfreundlichere Arbeitszeiten der Väter in Deutschland.
Zur heute anstehenden Entscheidung über ein weiteres Hilfspaket für Griechenland habe ich der Thüringer Allgemeinen ein Interview gegeben.