Für den heutigen „Der Freitag online“ habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Vielen Abgeordneten stand das Entsetzen noch ins Gesicht geschrieben, als sich die SPD-Bundestagsfraktion am 29. September zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl einfand. Mit einem derart niederschmetternden Ergebnis hatte niemand gerechnet. Schließlich hatten wir die Mehrheit der Bürger bei unseren zentralen politischen Themen wie Mindestlöhnen oder Atomausstieg auf unserer Seite gehabt. Und anders als bei den Bundestagswahlen 2005 war der SPD an ihren Infoständen kaum Unmut entgegengeschlagen, wie viele Kollegen einhellig berichteten.
Zwei Monate nach dem Schock vom 27. September ist in der SPD eine Debatte über die Deutung des Wahldebakels entbrannt. Welche Interpretation sich am Ende durchsetzt, entscheidet mit über den künftigen Kurs der SPD. Nach der einen Lesart sollte die SPD wieder gezielt ihre Stammklientel ansprechen und ihre großen Sozialreformen der vergangenen Jahre nachträglich als Fehler deklarieren, um enttäuschte Wähler zurückgewinnen – und anschlussfähig zu werden in Richtung Linkspartei. Ich dagegen bin überzeugt, dass diese Strategie der SPD lange Wanderjahre in der Opposition bescheren und eine schwarz-gelbe Hegemonie auf Jahre manifestieren würde. Die Verfechter eines Linksrucks gehen schlankerhand über die Tatsache hinweg, dass die SPD bei der Bundestagswahl laut der Analyse von Wahlforschern zwar 1,1 Millionen Wähler an die Linkspartei verlor, aber die weit größeren Verluste in der politischen Mitte der Gesellschaft verzeichnete: Rund 1,4 Millionen wechselten in das selbsternannte „bürgerliche“ Lager zu Union und FDP, 870.000 zu den Grünen, und 2,1 Millionen wurden zu Nichtwählern.
in der Mitte ist die Konkurrenz am härtesten
Die SPD kann die Wähler, deren Vertrauen sie verloren hat, nicht zurückgewinnen, indem sie einer dieser Wählergruppen hinterherläuft – genau darin besteht ihr Dilemma. Stattdessen muss die SPD für alle diese Menschen und Gruppen wieder attraktiver werden. Anders formuliert: Sie muss ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft verteidigen, die verloren gegangenen Randbereiche der Mitte zurückerobern und gleichzeitig ihre Stammklientel mobilisieren.
Die „Mitte“ mag ein soziologisch unscharfer Begriff sein. Niemand kann so genau sagen, wie sich diese Mitte zusammensetzt, wie sie sich verändert, wie sie tickt. Und sie ist ein politisch umkämpfter Begriff: Jeder reklamiert die Mitte für sich, mal als „Neue Mitte“, mal als „linke Mitte“, mal einfach als „Die Mitte“. Aber der Begriff ist genau deswegen so umkämpft, weil die Konkurrenz dort am härtesten ist, weil dort die Wahlen letztlich immer noch gewonnen werden. Auch den großen Erfolgen der Sozialdemokratie in der Vergangenheit ist stets eine Öffnung hin zur Mitte der Gesellschaft vorausgegangen – hin zu jenen gesellschaftlichen Gruppen, „die das Land prägen, ökonomisch, sozial und kulturell“ (Frank-Walter Steinmeier). Das gilt auch für die historischen Wahlsiege Gerhard Schröders und Tony Blairs, die jeweils unerträglich lange Phasen der Opposition beendeten.
Soziale Gerechtigkeit allein ist zuwenig
Diesmal muss die Phase der Opposition keineswegs so lange dauern. Denn ungeachtet des schlechten Wahlergebnisses steht die SPD programmatisch tatsächlich in der gesellschaftlichen Mitte. In Deutschland existiert eine „solidarische Mehrheit“, die mehr soziale Gerechtigkeit will, eine gute Gesundheitsversorgung für alle und keine Zwei-Klassen-Medizin, faire Löhne und Mindestlöhne, keine Steuersenkungen auf Pump, Chancengleichheit und bessere Schulen – all das sind sozialdemokratische Kernanliegen. Jedoch: Es wird nicht reichen, nur den Markenkern „soziale Gerechtigkeit“ zu stärken. Denn die meisten Bürger sind sich zugleich darüber im Klaren, dass jeder Euro, den der Finanzminister ausgibt, erst erwirtschaftet werden muss. Und dass nicht der Staat Arbeitsplätze schafft, wissen die Arbeiter, die Angestellten und die kleinen Selbständigen ebenfalls sehr genau. Will die SPD wieder Wahlen gewinnen, muss die SPD soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Dynamik gleichermaßen verkörpern. Gerhard Schröder brachte diese Erkenntnis 1998 auf die erfolgreiche Formel „Innovation und Gerechtigkeit“. Mit diesem Slogan mobilisierte die SPD ihre Stammwähler, erschloss neue Wählerschichten in der Mitte – und erhielt am Ende 40,9 Prozent der Stimmen.
Im Jahr 2009 lag die SPD bei der Kompetenzzuschreibung der Wähler auf dem Gebiet „Wirtschaft voranbringen“ hoffnungslos hinter der Union zurück (21 zu 47 Prozent). Nur 38 Prozent der Wähler stimmten der Aussage zu, die SPD habe gute Ideen für neue Arbeitsplätze. Wohl auch aus diesem Grund haben deutlich mehr Arbeiter und Angestellte für die CDU/CSU gestimmt, als für die SPD. Allem Anschein nach schaffen es die Sozialdemokraten nicht, in der größten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren, nach dem grandiosen Scheitern der marktradikalen Ideologie, als glaubwürdige Vertreter einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik wahrgenommen zu werden. Dabei entsprechen ihre wirtschaftspolitischen Grundpositionen – Nachhaltigkeit, langfristiges Wachstum, handlungsfähiger Staat – wie nie zuvor dem Zeitgeist. Auch hat sich in der Krise die sozialdemokratische Philosophie des „Dritten Weges“ bewahrheitet: Weder der Markt noch der Staat können allein erfolgreich agieren; beide Seiten müssen in einer vernünftigen Balance stehen.
Lehrstück Opel
Aus meiner Sicht beschränkt sich die SPD in der Wirtschaftspolitik allzu oft auf Einzelforderungen („Mindestlöhne!“), auf Beschimpfungen der Gegenseite („Schwarz-Gelb steht für soziale Kälte!“) – oder auf Abwehrreaktionen gegen die Globalisierung („Das ist mit uns nicht zu machen!“). Die Rettungsaktion für Opel im Wahlkampf ist ein lehrreiches Beispiel. Während sich Freiherr zu Guttenberg als strenger Ordnungspolitiker profilierte, konnte die SPD aus ihrer Forderung nach Milliardenhilfen aus dem Staatshaushalt kaum Kapital schlagen. Zusätzliche Wählerstimmen gab es noch nicht einmal in Rüsselsheim. Auch nicht in Bochum, nicht in Kaiserslautern, nicht in Eisenach. Denn die Bürger wussten, dass die zentralen Entscheidungen in Übersee gefällt wurden, und nicht in Berlin. Sie spürten, dass es in einer Branche mit enormen Überkapazitäten zwangsläufig zu strukturellen Veränderungen kommen wird. Überdies kannten sie die riesigen Löcher im Staatshaushalt. Bis heute spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gegen Staatshilfen für Opel aus.
Wo ist das positive Leitbild der SPD?
Offensichtlich erwartet die gesellschaftliche Mitte von der SPD mehr als den bloßen Bau von Trutzburgen gegen die Kräfte der Märkte. Dringend notwendig wäre, dass die SPD ein eigenes positives Leitbild vertritt, wie wir angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wirtschaften sollten: Viel häufiger als bisher sollten Sozialdemokraten auch von den Chancen der Globalisierung sprechen, von Zukunftsbranchen wie den Alternativen Energien, in denen neue Arbeitsplätze entstehen, von einem handlungsfähigen Staat, der reguliert und fördert, und von vorsorgender Sozialpolitik, die die Menschen im unvermeidlichen Strukturwandel stärken und unterstützen kann. Diese Ziele können wir allerdings nur erreichen, wenn wir die Globalisierung gestalten, anstatt sie zu bekämpfen. Dafür wiederum brauchen wir internationale Partner. Die SPD kann nur dann glaubhaft eine progressive Wirtschaftspolitik vertreten, wenn sie offensiver als bisher Verbündete in Europa und in der Welt sucht. Ein wichtiger Schritt wäre es, mit den übrigen sozialdemokratischen Parteien Europas enger zusammenzuarbeiten.
Anpassung an die Linkspartei ist ein Irrweg
Eine solche optimistische wirtschaftspolitische Erzählung, die auf die Mitte der Gesellschaft zielt, ist in Deutschland auch deshalb eine Marktlücke, weil Union und FDP eben jene haushaltspolitisch unseriöse und volkswirtschaftlich wirkungslose Klientelpolitik betreiben, vor der die SPD im Wahlkampf gewarnt hat. Und nicht zuletzt wäre eine solche sozialdemokratische Strategie der Mitte auch für ein rot-rot-grünes Bündnis förderlich. Denn die Linkspartei hat nur eine einzige Chance, an die Regierung zu kommen: Sie muss mit der SPD koalieren. Die SPD kann immer auch anders. Igelte sich die SPD in ein „linkes Lager“ ein, würde sie nicht nur ihre günstige Mittelstellung im Mehrparteiensystem aufgeben, sondern auch den Druck von der Linkspartei nehmen, endlich weltfremde Positionen zu räumen – und damit überhaupt erst Regierungsfähigkeit zu erlangen.
Die umgekehrte Anpassung der SPD an Lafontainesche Positionen wäre hingegen schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil die Grünen dieses Spiel nicht mitmachen würden. Einmal abgesehen davon, dass ein solches Bündnis überhaupt nur dann mehrheitsfähig werden kann, wenn sich die potenziellen Partner auf eine gewisse Arbeitsteilung verständigen. Will die SPD im Jahr 2013 die Option haben, mit Linkspartei und Grünen zu koalieren, darf sie die Mitte nicht aufgeben.
(c) Der Freitag online


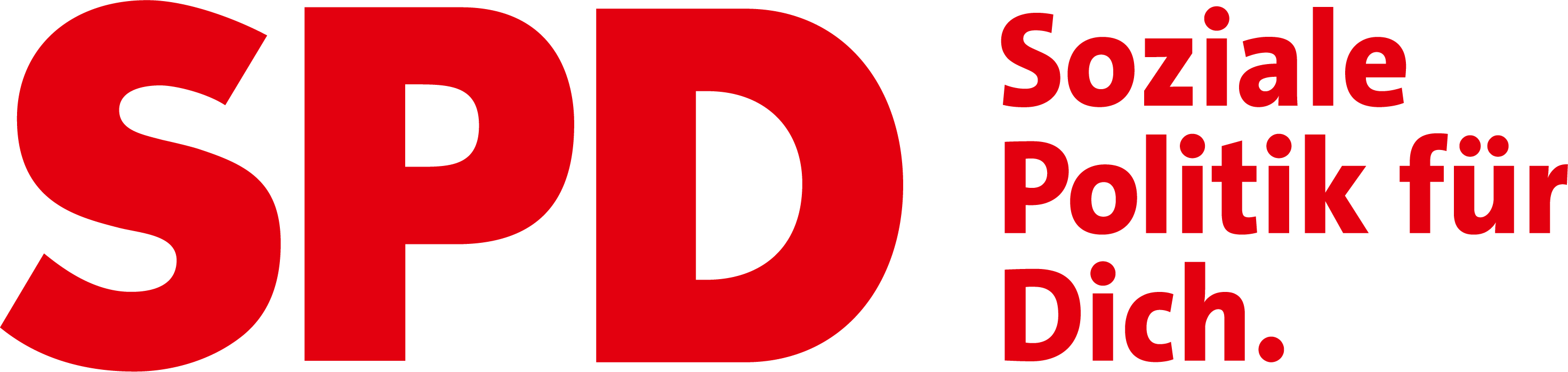

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!